Jedes Jahr zum Jahreswechsel nehmen wir uns Zeit, Freunden und Familie Glückwünsche für das neue Jahr zu senden. Dieser Brauch, der heute oft per Nachricht oder Karte – insbesondere über digitale Kanäle wie WhatsApp und Co. – übermittelt wird, hat eine lange und reiche Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht.
Was wir als Neujahrsgruss kennen, hat sich über Jahrtausende entwickelt und war stets ein Spiegel der kulturellen und sozialen Veränderungen seiner Zeit. In diesem Beitrag werfe ich einen Blick auf die Ursprünge und Entwicklung dieser Tradition.
Neujahrswünsche in der Antike: Der Ursprung des Brauchs
Bereits in den frühesten Zivilisationen war der Jahreswechsel ein bedeutendes Ereignis. Die alten Ägypter, eine der ältesten bekannten Hochkulturen, nutzten den Jahreswechsel, um einander gute Wünsche zu übermitteln. Diese wurden oft mit kleinen Geschenken wie mit Spezereien gefüllten Fläschchen begleitet. Inschriften und archäologische Funde bestätigen diese Praxis, die als Vorläufer unserer heutigen Neujahrskarten gesehen werden kann.
Auch in Mesopotamien und im antiken Persien gab es ähnliche Bräuche. Besonders interessant ist der Neujahrsbrauch der Perser, die einander Eier schenkten – ein Symbol für neues Leben und Fruchtbarkeit. Solche Gaben waren nicht nur ein Akt der Freundlichkeit, sondern auch Ausdruck von Hoffnung und Optimismus für das kommende Jahr.
Neujahrsfeste bei den Römern: Lorbeerzweige und Luxusgeschenke
In der römischen Antike wurde der Neujahrstag dem Gott Janus gewidmet, der als Herrscher über Anfang und Ende galt. Die Römer tauschten an diesem Tag Geschenke aus, um Wohlstand und Glück für das neue Jahr herbeizuwünschen. In den frühen Jahren des Römischen Reiches bestanden diese Gaben oft aus Lorbeerzweigen, die später durch luxuriösere Geschenke wie Münzen, Prunkvasen oder sogar wertvolle Stoffe ersetzt wurden.
Besonders interessant ist die Rolle der sozialen Hierarchie bei diesen Gaben. Während Untergebene ihren Herren oft kostbare Geschenke darbrachten, um sich deren Gunst zu sichern, verbanden Herrscher und hohe Beamte die Geschenke mit der schriftlichen oder mündlichen Übermittlung von Glückwünschen. Diese Praxis etablierte die ersten Vorläufer von Neujahrsgrüssen in der schriftlichen Form.
Das Mittelalter: Der Einfluss der Christenheit
Mit der Christianisierung Europas wandelte sich der Charakter der Neujahrswünsche. Die Kirche versuchte zunächst, die heidnischen Bräuche zu unterbinden, doch viele Traditionen blieben bestehen. Statt luxuriöser Geschenke ermutigte die Geistlichkeit dazu, Almosen an die Armen zu geben. Dennoch blieben Neujahrswünsche und -geschenke tief in der Kultur verwurzelt und wurden zu einem wichtigen Bestandteil des mittelalterlichen Lebens.
Im frühen Mittelalter wurden Neujahrsgrüsse vor allem mündlich ausgetauscht, oft in Verbindung mit geselligen Besuchen und festlichen Gelagen. Später, mit der zunehmenden Verbreitung der Schreibkunst, entstanden schriftliche Neujahrswünsche. Eine der gebräuchlichsten Formulierungen lautete damals: «Gott gebe dir und uns allen ein gut selig neu Jahr und nach diesem Leben das ewige Leben. Amen.»
Der Buchdruck und die Geburt der Neujahrskarten
Die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Neujahrswünsche. Es war nun möglich, Grusskarten in grösserem Umfang herzustellen und zu verbreiten. Der älteste bekannte gedruckte Neujahrsgruss stammt aus dem Jahr 1466 und wurde von Meister E. S., einem der ersten deutschen Kupferstecher, geschaffen. Auf einer künstlerisch gestalteten Karte war das Christuskind abgebildet, begleitet von dem Wunsch: «Ein goot selig jor.»
Im Laufe der Zeit wurden diese gedruckten Karten immer kunstvoller. Oft waren sie mit aufwendigen Ornamenten und Bildern verziert, die sowohl religiöse als auch weltliche Themen darstellten. Besonders beliebt war die Darstellung des Jahreswechsels als Moment der Hoffnung und Erneuerung.
Volksbräuche und «Klopf an»-Verse
Neben den offiziellen und gedruckten Neujahrswünschen existierten zahlreiche Volksbräuche, die das einfache Volk pflegte. Einer der charmantesten Bräuche war der sogenannte «Klopf an»-Ritus. Dabei gingen Menschen von Tür zu Tür, klopften an und trugen gereimte Glückwünsche vor. Diese Verse begannen oft mit den Worten «Klopf an!» und dienten nicht nur der Übermittlung von Wünschen, sondern auch dazu, kleine Gaben wie Essen oder Münzen zu erbitten.
Ein Beispiel für einen solchen Vers lautet:
Klopf an, mein Herz und mein Hort,
und hör‘ in Gut‘ mein freundlich Wort.
Diese Tradition, die besonders im 17. und 18. Jahrhundert populär war, zeigt, wie kreativ und vielfältig die Übermittlung von Neujahrswünschen gestaltet werden konnte.
Vom handgeschriebenen Gruss zur digitalen Botschaft
Mit der Industrialisierung und der Erfindung der Postkarten wurde der Austausch von Neujahrswünschen noch einfacher. Die kunstvoll gestalteten Karten des 19. Jahrhunderts waren oft reich an Symbolen wie Kleeblättern, Schweinchen und Hufeisen – alles Zeichen des Glücks.
Im 20. Jahrhundert setzten sich dann maschinell gefertigte Karten durch, die in riesigen Mengen produziert wurden. Heute hat sich die Übermittlung von Neujahrsgrüssen stark digitalisiert. SMS, E-Mails und soziale Medien haben die gedruckte Karte in vielen Fällen ersetzt. Doch die Grundidee – anderen Glück und Erfolg für das neue Jahr zu wünschen – ist zeitlos geblieben.
Eine Tradition der Menschlichkeit
Die Geschichte der Neujahrswünsche zeigt, wie tief verwurzelt der Wunsch ist, anderen Glück und Wohlstand zu wünschen. Ob in der Antike, im Mittelalter oder in der Moderne – Neujahrswünsche sind ein Ausdruck von Gemeinschaft und Hoffnung. Sie haben sich an die technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen angepasst, ohne ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren. Vielleicht denkst Du beim nächsten Neujahrsgruss daran, wie weit dieser Brauch zurückreicht und welche Bedeutung er in der Menschheitsgeschichte hatte.
Literaturhinweise
- Davies, Norman: Europe: A History. HarperCollins, 1996.
- Hutton, Ronald: The Stations of the Sun: A History of the Ritual Year in Britain. Oxford University Press, 1996.
Mit diesen historischen Einblicken wünsche ich ein frohes neues Jahr – möge es voller Glück und Erfolg sein!

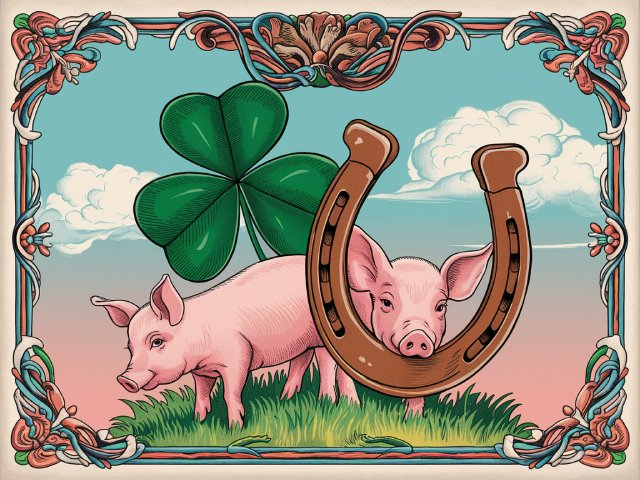

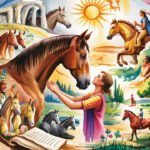



0 Kommentare