Die Schweizer Trachten, wie wir sie heute an Festen, in Trachtenvereinen bewundern, sind nicht einfach historische Überbleibsel. Sie sind das Ergebnis einer kulturellen Neuschöpfung – angestossen von einem Mann, der nicht nur Agrarpolitiker, sondern auch Kulturstratege war: Ernst Laur.
Der letzte Atem der Vielfalt
«So wie die Gletscher unseres Alpenlandes sich Jahr für Jahr zurückziehen,» schrieb Ernst Laur 1939, «so hat der Atem unserer gleichmachenden Zeit auch das bäuerliche Eigenwesen eingeschmolzen und zum Verschwinden gebracht.» Dieser Satz bringt auf den Punkt, was Laur zeitlebens beschäftigte: Die Angst vor dem Verlust gewachsener, ländlicher Identität im Strudel der Moderne.
Laur (1871–1964) war eine Schlüsselfigur der Schweizer Agrar- und Kulturpolitik. Als Direktor des Schweizerischen Bauernverbands von 1898 bis 1939 vertrat er nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern auch ein klar umrissenes gesellschaftliches Leitbild: Die Schweiz sei dann stark, wenn der Bauernstand stark sei – kulturell, wirtschaftlich und politisch.
Seine Vorstellung war ständestaatlich geprägt: Er sah den Bauernstand als eigenen «Stand» neben dem Bürgertum und dem Proletariat, als tragende Säule der Nation mit eigenständiger Würde. Diese Überzeugung führte ihn bald über die Landwirtschaft hinaus – hinein in die Kulturpolitik.
Vom Verschwinden zur Wiederbelebung
Im 19. Jahrhundert verschwanden vielerorts die traditionellen Bauerntrachten aus dem Alltagsleben. Der Fortschritt, der Wandel der Mode und die Industrialisierung machten die schwere, handgefertigte Tracht unpraktisch und überflüssig. Was blieb, waren vereinzelte Erinnerungen, Fotografien und museale Stücke.
Laur sah darin nicht nur einen Verlust an Kleidung, sondern einen Verlust an kollektiver Identität. Und so setzte er sich in den 1920er- und 1930er-Jahren mit ganzer Kraft dafür ein, die Schweizer Trachten neu zu beleben – nicht als exakte historische Reproduktion, sondern als symbolische Rückbesinnung auf bäuerliche Werte und Heimatverbundenheit.
Dabei ging er strategisch vor: Als Präsident der 1926 gegründeten Schweizerischen Trachtenvereinigung und Mitbegründer des Schweizerischen Heimatwerks (1930) baute er die nötigen Strukturen auf. Unter seiner Führung wurden regionale Trachten neu entworfen, oft unter Einbezug historischer Elemente, aber mit dem klaren Ziel einer harmonischen, ästhetischen und «würdigen» Repräsentation der Schweiz.
Die Entwürfe stammten meist nicht aus der Bevölkerung selbst, sondern wurden von Textildesignern, Schneiderinnen und Historikern erarbeitet – sorgfältig, aber eben auch stilisierend. So entstand eine moderne Trachtenwelt, die mehr mit der kulturellen Selbstinszenierung als mit dem realen bäuerlichen Alltag früherer Jahrhunderte zu tun hatte.
«Schweizer Art ist Bauernart» – ein ideologischer Leitsatz
Laurs bekanntes Motto «Schweizer Art ist Bauernart» war mehr als ein Slogan. Es war eine kulturpolitische Botschaft. In einer Zeit, in der sich Europa ideologisch auflud und sich nationale Identitäten formierten, wollte Laur der Schweiz eine eigene kulturelle Grundlage sichern – nicht durch Abgrenzung nach aussen, sondern durch innere Stärkung.
Die neu geschaffenen Trachten wurden zum sichtbaren Symbol dieser Vision. Sie waren Teil einer grösseren Bewegung, die man heute unter dem Begriff geistige Landesverteidigung zusammenfasst. In den 1930er-Jahren – unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise, wachsender Urbanisierung und politischer Instabilität in Europa – suchte die Schweiz Halt in der eigenen Tradition.
Laur lieferte diesen Halt in Form einer ästhetisch geordneten Vergangenheit, die sich gut vorzeigen liess: auf Bühnen, in Festumzügen, in Heimatschauen. Die Trachten wurden zu Insignien eines idealisierten Bauerntums – nicht selten von Menschen getragen, die selbst nie eine Tracht geerbt hatten.
Die Landesausstellung 1939: Höhepunkt der Inszenierung
Der Höhepunkt dieser Entwicklung war die Landesausstellung von 1939 in Zürich. Inmitten eines zunehmend bedrohlichen Europas inszenierte sich die Schweiz als ein Hort von Ordnung, Volksnähe und Selbstbehauptung. Die Figur des Bauern mit der Sense, die Silhouette des «Landi-Bauern», wurde zur Ikone.
Trachtenträgerinnen und -träger waren überall präsent: in Chören, Tanzgruppen, Zeremonien. Die entworfene Vergangenheit wurde zur nationalen Gegenwart. Ernst Laur hatte mit seiner Kulturpolitik genau auf diesen Moment hingearbeitet – und ihn vorbereitet.
Doch bei aller Wirkung blieb das Projekt ambivalent: Was als «Wiederbelebung» verkauft wurde, war in Wahrheit oft eine Neuschöpfung. Die Authentizität wurde suggeriert, nicht gelebt. Viele Trachten waren Produkte des 20. Jahrhunderts, mit alten Stoffmustern, aber neuen Schnitten und frischem Symbolgehalt.
Nachwirkung und Neubewertung
Ernst Laurs Wirken prägt die Schweizer Volkskultur bis heute. Viele der damals entworfenen Trachten sind heute noch im Einsatz – in Trachtenvereinen, bei Festumzügen, im Folklorefernsehen. Sie gelten als Inbegriff schweizerischer Tradition, obwohl sie in vielem Produkte einer ideologisch geprägten Zeit sind.
Laur bleibt eine faszinierende Figur: Einerseits ein Pragmatiker, der kulturelle Prozesse zu steuern wusste, andererseits ein Romantiker, der an die moralische Kraft des Bauernstandes glaubte. Seine Vorstellung einer ständisch gegliederten Gesellschaft mag heute veraltet erscheinen – seine Wirkung auf das kulturelle Selbstbild der Schweiz jedoch ist unbestreitbar.
Wenn also heute jemand fragt: «Wie sieht eine echte Schweizer Tracht aus?», dann lautet die ehrliche Antwort: «Das kommt ganz darauf an – auf die Region, die Zeit, und auf Ernst Laur.»
Denn was wir heute für uralt halten, wurde oft in Sitzungszimmern der 1930er-Jahre entworfen, mit Lineal, Stoffmustern und einem klaren Auftrag: Zeigt, was schweizerisch ist – auch wenn ihr es neu erfinden müsst.

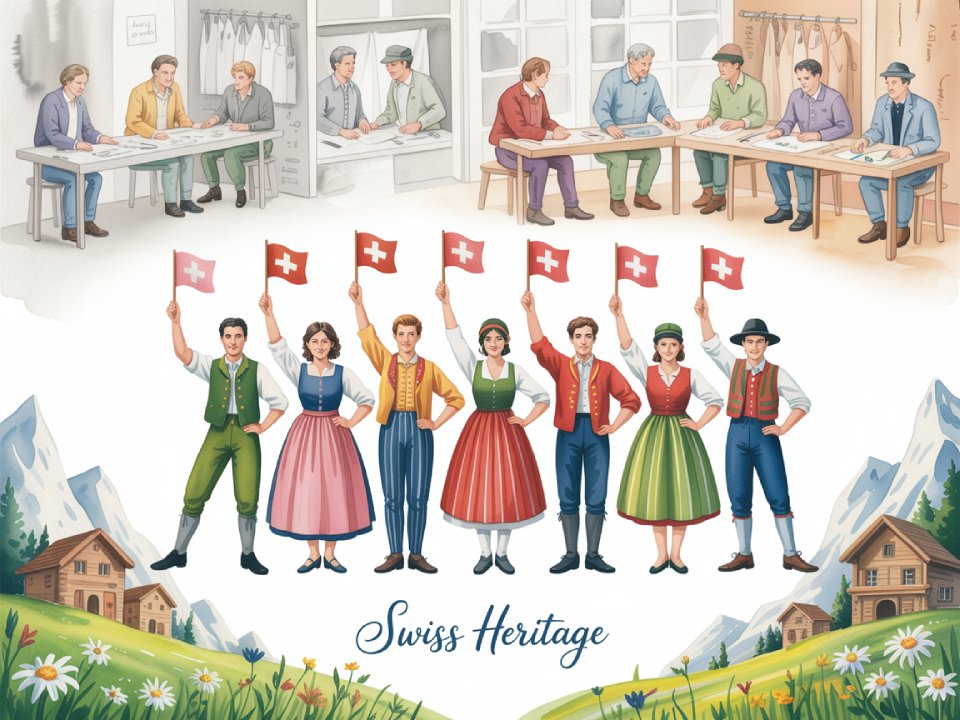





0 Kommentare