Archäologische Sensationsfunde geschehen oft durch Zufall. So auch im Jahr 1788, als sechs Arbeiter in einer Kiesgrube bei Waldenburg auf geheimnisvolle Bronzeobjekte stiessen. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Arbeitstag begann, wurde schnell zu einer historischen Entdeckung: Römische Statuetten, ein beschrifteter Sockel und ein antiker Schlüssel kamen ans Licht.
Doch wie kamen diese Relikte dorthin? Handelte es sich um die Überreste eines römischen Heiligtums? Oder war es eine verlorene Weihgabe aus einer nahegelegenen Villa? Bis heute gibt es mehr Fragen als Antworten – und eine gehörige Portion Dramatik, denn der Fund führte zu jahrelangen Streitigkeiten zwischen einem eigensinnigen Handschuhmacher und den Behörden.
Der Handschuhmacher und die Grube
Unser Protagonist der Geschichte ist Johann Jakob Baumann, ein streitlustiger Handschuhmacher aus Waldenburg. Er besass ein Stück Land am Richtiberg, genauer gesagt im sogenannten Areisli, einer Hanglage ausserhalb der Stadtmauern.
Doch 1785 kam ein Basler Brunnmeister mit einem Anliegen: Die Stadt Basel brauchte Kies für den Strassenbau, insbesondere für die Hauensteinstrasse, die Nord- und Südschweiz verband. Man bot Baumann eine Summe für ein Stück seiner Geröllhalde an, und obwohl ihm der Preis zu niedrig erschien, willigte er schliesslich ein.
Drei Jahre später, 1788, arbeiteten mehrere Männer aus Reigoldswil und Oberdorf in der neu entstandenen Grube. Dabei geschah das Unerwartete: Bronzestatuetten, ein Sockel mit lateinischer Inschrift, ein alter Schlüssel und weitere Metallobjekte kamen zum Vorschein.
Ein Fund mit Folgen
Die Arbeiter nahmen die Bronzefiguren mit nach Hause, wo sie bald die Aufmerksamkeit des Reigoldswiler Pfarrers J. J. Bachofen erregten. Dieser informierte den Bürgermeister von Niederdorf, der wiederum Basel alarmierte.
Denn damals galt eine klare Regel: Alle «fundenen Güter» gehörten automatisch der Obrigkeit in Basel. Bereits am 21. Mai 1788 wurde der Fund offiziell gemeldet und eine Liste der Objekte erstellt:
- Minerva-Statuette (Göttin der Weisheit)
- Kleine Minerva-Statuette
- Merkur-Statuette (Gott des Handels)
- Ein bronzener Sockel mit lateinischer Inschrift
- Ein altes Männlein (möglicherweise Herkules?)
- Ein römischer Schlüssel
Die Basler Behörden nahmen die Funde in Besitz und übergaben sie dem bekannten Professor Dr. D’Annone, einem Spezialisten für Altertumskunde.
Was sagten die Experten?
Dr. D’Annone untersuchte die Fundstücke und kam zu dem Schluss, dass es sich um hochwertige römische Kunstwerke handelte, vermutlich aus dem 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr.. Besonders beeindruckte ihn die grössere Minerva-Statuette, die einst wohl eine Lanze in der Hand hielt.
Besonderes Interesse weckte der bronzene Sockel mit der Inschrift:
TAURICUS CARATI DE SUO D. D.
Die Übersetzung gab Rätsel auf. Möglich war:
- «Tauricus hat es Carates aus seinem Besitz geschenkt.»
- «Tauricus Caratius (oder Caratinus) hat es aus seinem Besitz gestiftet.»
- (Moderne Interpretation) «Tauricus, Sohn des Caratus, hat es als Geschenk gegeben.»
Der Fund deutete darauf hin, dass es in der Gegend eine römische Siedlung oder ein Heiligtum gegeben haben könnte. Doch die Frage blieb offen: Woher stammten diese Objekte?
Der Prozess – Baumann gegen Basel
Während die Wissenschaftler die Funde analysierten, hatte Johann Jakob Baumann ganz andere Pläne.
Er behauptete, dass die Objekte auf seinem ehemaligen Land gefunden wurden – und dass ihm daher eine Entschädigung zustünde! Er begann einen jahrelangen Rechtsstreit gegen das Bauamt und die Basler Regierung, verlangte Schadenersatz und die Rückgabe der Bronzestatuen.
Doch die Basler Behörden blieben hart:
Sie verwiesen darauf, dass «fundene Güter» dem Staat gehörten.
Sie argumentierten, dass Baumann seinen Landverkauf bereits abgeschlossen hatte.
Als Baumann sich weiter wehrte, wurde er mit einer Geldstrafe belegt.
Doch Baumann liess nicht locker. Er wandte sich 1798 an die neue helvetische Regierung und berief sich auf die Prinzipien der Französischen Revolution: «Freiheit, Gleichheit, Eigentum!»
Sogar die Arbeiter, die die Bronzefunde gemacht hatten, forderten einen Finderlohn.
Das Basler Direktorium gab schliesslich nach: Jeder Finder erhielt einen Louisdor (Goldmünze) als Belohnung.
Baumann selbst ging leer aus. Er fiel in Armut und wurde schliesslich mittellos vom Waldenburger Unterstatthalter an die Regierung empfohlen – mit der Bitte, ihm eine Arbeit zu geben.
Quelle: Dr. Heinrich Weber, Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte Baselland, Band 18, 1953



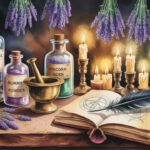



0 Kommentare