Ob es sie noch gibt, die echte Volksmusik? In einem Europa, das sich annähert, das sich vernetzt, durchmischt und dabei Vieles angleicht?
Die Frage stellt sich, leise zwar, aber sie lässt nicht los.
Ich habe einen Begriff von Volksmusik, der nichts mit Trachtenbühnen oder volkstümlicher Dauerberieselung zu tun hat. Für mich ist Volksmusik etwas, das aus der Tiefe eines gelebten Alltags entsteht. Eine Musik, die aus der Landschaft klingt, aus dem Rhythmus der Jahreszeiten, aus dem Klang der Sprache, aus der Art, wie Menschen arbeiten, lieben, glauben und feiern.
Sie wächst nicht am Reissbrett, sondern im Zusammenspiel von Generationen – mal getragen, mal schalkhaft, mal traurig, mal verschmitzt.
Solche Musik ist nicht bloss Dekoration. Sie hat Verbindendes, etwas, das Menschen zusammenführt, das Erinnerungen trägt, das auch dort spricht, wo die Sprache schweigt. Vielleicht ist das der eigentliche Wert: dass sie uns berührt, ohne sich aufzudrängen. Dass sie aus der Volksseele kommt – und genau dorthin zurückwirkt.
Doch ist so etwas heute überhaupt noch möglich?
Zwischen Weltoffenheit und Gleichklang
Wir leben in einer Zeit, in der Musik fast überall und jederzeit verfügbar ist. Was irgendwo auf der Welt aufgenommen wird, kann Sekunden später schon hier gehört werden. Es ist eine erstaunliche Freiheit – und doch auch eine Überflutung.
Denn neben der Vielfalt wächst auch die Uniformität: Viele Lieder klingen ähnlich, werden nach denselben Produktionsregeln gemacht, mit Blick auf Reichweite und Marktwert. Der Tonfall der Welt ist oft laut, glatt und schnell.
In diesem Umfeld hat es die leise, aus einer bestimmten Kultur gewachsene Musik schwer. Sie wird leicht überhört – oder sie wird als Folklore in eine Nische gestellt, fern vom «Hier und Jetzt».
Und doch – sie lebt
Trotzdem begegnet man ihr. Selten vielleicht, aber eindrücklich. Manchmal auf einer Wanderung, wenn ein Alphornbläser seine Klänge in den Hang stellt – nicht für ein Publikum, sondern für die Berge. Oder bei einer Stubete, wenn drei Musiker zusammenspielen, ohne Absprache, getragen von Erfahrung, Stimmung und gegenseitigem Spüren.
Und es gibt auch junge Musikerinnen und Musiker, die sich mit der Volksmusik ihrer Region beschäftigen, die Neues versuchen, ohne das Alte zu verraten.
Sie nutzen andere Mittel, vielleicht auch andere Instrumente, auch neue Medien – aber sie horchen zuerst, bevor sie etwas hinzufügen.
Kein Massenprodukt – aber ein Schatz
Volksmusik im ursprünglichen Sinn ist keine Ware. Sie will nicht gefallen, sondern begleiten. Sie will nicht verkaufen, sondern verbinden.
Und vielleicht ist gerade das heute ihr besonderer Wert.
Es braucht nicht viel – nur etwas Aufmerksamkeit.
Ein Ohr für die Zwischentöne.
Ein Herz für das Eigene.
Und die Bereitschaft, das Unscheinbare nicht vorschnell beiseitezuschieben.
Dann kann man ihr begegnen – der Musik, die nicht bloss gespielt, sondern gelebt wird.





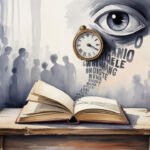

0 Kommentare