Hin und wieder tauche ich in meinen Erinnerungen ab – und lande in einer Welt, die es so nicht mehr gibt. Eine dieser Welten war das «Jägerli», ein kleines Wirtshaus in meinem Heimatort. Es war mehr als eine Beiz (so nennen wir in der Schweiz eine einfache Gaststätte) – es war ein Mikrokosmos voller schrulliger Originale, deftiger Sprüche, wilder Geschichten und eigensinniger Rituale. In dieser Geschichte erzähle ich von einer Zeit, in der man sich abends traf, um zu reden, zu lachen, zu trinken – und manchmal auch zu streiten. Eine humorvolle und herzliche Erinnerung an ein Stück gelebter Dorfkultur.
Es gibt Orte, die verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen – und es gibt solche, die im kollektiven Gedächtnis eines Dorfes weiterleben. Das Jägerli gehört zweifellos zur zweiten Sorte. Heute existiert es nicht mehr – doch wer das Dorfleben von früher kannte, weiss noch genau, wo das Jägerli war und was es bedeutete. Es war weit mehr als nur eine Beiz – es war eine Institution. Ein Treffpunkt für Männer aller Schichten, vom Handwerker bis zum Fabrikanten, vom Knecht bis zum Offizier.
Frauen waren damals in den dörflichen Wirtshäusern kaum je anzutreffen. Nicht, weil sie ausgeschlossen gewesen wären – sondern weil es die unausgesprochene Ordnung so vorsah. Die Beiz war Männerterrain, ein Raum für Diskussionen, Wortgefechte, Lieder und Lacher – oft bis tief in die Nacht. Wer das Jägerli betrat, wurde Teil einer Gemeinschaft, die nach eigenen Regeln lebte: manchmal derb, oft herzlich, immer unverwechselbar.
In dieser kleinen Beizenbetrachtung soll nicht das gesamte Kapitel Jägerstübli beleuchtet werden, sondern eine ganz bestimmte Ära – nämlich jene, in der Hans und Emmi Glutz das Zepter führten. Die beiden prägten das Jägerli wie kaum jemand vor oder nach ihnen. Ein Wirtepaar, wie es im Buche steht – auch wenn dieses Buch wohl eher im Regal mit der Aufschrift «Amüsante Dorfgeschichten» zu finden wäre.
Hans Glutz, ein Original aus Derendingen, war derb, laut, zuweilen furchteinflössend – und dennoch auf seine Art herzlich. Emmi, seine Frau, brachte das nötige Gleichgewicht in die Beiz: pragmatisch, bodenständig, mit wachem Blick fürs Wesentliche. Dass dieses Gespann harmonierte, erstaunte viele – zumal Hans allabendlich zum ritualisierten Ausbruch neigte:
«I hau dr ä Chaib ufs Nasebai – Boxclub Derendingen!»
Seine liebenswürdigen Redensarten waren im Dorf längst geflügelte Worte geworden:
«Naggischopf, Zibelegränni, allne Lüt Verleider, truurige Elände!»
Auch sein Morgengebet, das mit einem schrägen
Dona dona nobis
d Chatz frisst ä Brotis – Halleluja!
Si het no nüt z Morge gha
begann und mit dem kernigen
Du bisch dr dümmscht Chaib, wo Mähl röschtet, wiit und breit im ganze Land!
endete, war mehr Volkskultur als Gottesdienst.
Hans war keine Leuchte der Betriebswirtschaft – das wusste er, das wussten alle. Aber irgendwie hielt er seine Beiz in Schwung. Mit Instinkt, Improvisationstalent und einer erstaunlichen Gabe: Auch wenn er sich schon ein paar Bierchen genehmigt hatte, wusste er in der Küche genau, was er tat. Seine Gerichte schmeckten – überraschend oft – gar nicht so schlecht. Wie er das hinkriegte, blieb sein Geheimnis. Vielleicht war’s einfach Liebe zur Beiz. Oder Emmi.
Am runden Stammtisch sass oft Hans Egli, der nicht müde wurde zu betonen, dass er es trotz einfacher Herkunft zum Offizier der Schweizer Armee gebracht hatte. Politik und Militär waren seine Lieblingsthemen. Das Biertrinken überliess er lieber dem Proletariat – er bevorzugte ein Glas Weisswein. Wenn die Rede auf Politik oder militärische Fragen kam, reckte er das Kinn, nahm einen Schluck und begann, seine Thesen über Disziplin und Ordnung zu verfechten. Wer widersprach, war für ihn ein «Banause!».
Nicht weit von ihm sass Degen Dolfeli und schlückelte sein Zweierli Oran. Er war von kleiner, kugelrunder Statur und stets bereit, in seiner schrulligen Art einen Beitrag zur Runde zu leisten. Sein Zuhause lag zwar vis-à-vis vom Jägerli, doch sein eigentliches Wohnzimmer war die Gaststube selbst. Nach einem langen Arbeitstag in der Rero zog es ihn schnurstracks an seinen Stammplatz, wo er seine Abende verbrachte, als gäbe es keinen besseren Ort auf der Welt.
Schwiizer Willy, der als Knecht auf der Au arbeitete, war eine weitere feste Grösse im Jägerli. Er rauchte überall und war bekannt dafür, seine Zigaretten achtlos zu Boden zu werfen. Die Bauers- und Wirtefamilie Ballmer musste stets auf der Hut sein, damit Willy ihnen nicht den Heustock abfackelte. Doch wenn es ums Jassen ging, machte ihm keiner etwas vor – da war er unschlagbar.
Einmal kippte Glutz Hans aus nicht weiter erklärbaren Gründen Franz Degen sen., dem Dero-Fabrikanten aus dem Tschoppenhof, ein halbes Glas Bier über den Kopf. Franz, der sich nicht so leicht aus der Fassung bringen liess, nahm kurzerhand den Servierschurz von Nora, der legendären Serviertochter, und tupfte sich damit sorgsam die Stirn. Der Vorfall war damit erledigt. Am nächsten Abend erschien Franz mit einer nagelneuen Schürze für Nora. Ordnung musste sein.
Nora war eine Blondine – und natürlich der Mittelpunkt der Männerrunde, die zu später Stunde gerne in Gesang ausbrach. Insbesondere Heinimann Dölfi und Schnauzer-Fritz hatten die Neigung, nach der vierten Runde «Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr» anzustimmen, was regelmässig von Annäherungsversuchen an Nora begleitet wurde. Sie nahm es mit stoischer Ruhe hin, servierte weiter und kassierte grosszügige Trinkgelder.
Eine feste Grösse im Jägerli war auch Bader Edi. Seine geflügelten Worte lauteten: «I bi supergenau im Bild» oder – wenn man ihn ungläubig anschaute – «Dasch kei Witz!», wobei man sich nie ganz sicher war. Und wenn ihm etwas zu weit ging, sagte er mit fester Stimme: «Mir wei nid blöd werde!» – ein Satz, der oft mehr Wirkung hatte als ein ganzes Referat.
Nach einem Schützenfest kehrte er, mit dem Karabiner im Gepäck, ins Jägerli ein, stellte das Gewehr bei der Garderobe ab und begoss seinen errungenen Schützenkranz im Kreis der üblich Verdächtigen. Glutz Hans, jederzeit zu einem Scherz aufgelegt, schlich sich zur Garderobe, nahm den Karabiner und versteckte ihn im Putzkämmerchen.
Als Edi zu später Stunde aufbrach, bemerkte er natürlich das Fehlen seines Gewehrs – und war ausser sich. Er vermutete zwei Jünglinge als Täter und drohte, die Polizei einzuschalten. Zwei Tage blieb der Karabiner verschwunden. Doch am Mittwochabend stand er plötzlich wieder da – mutterseelenallein in der Garderobe, als sei nichts gewesen.
Dann war da noch der legendäre Gysi Hansruedi, genannt Chohle-Gysi oder auch Ölscheich. Seine Geschichten waren so grandios, dass die meisten sie gar nicht hinterfragten. Eine heitere Episode spielte sich zwischen ihm und Gentsch Eugen ab. Hansruedi meinte, er habe Aktien von aufstrebenden Atomkraftwerken gekauft – trotz der vielen, die dagegen seien, wie er betonte. Eugen, der nichts von Atomkraft wissen wollte, sah ihn betroffen an und sagte: «Herr Gysin, so geht das nicht – von nun an sind wir per Sie!»
Hansruedi erwiderte trocken: «Ich bin froh, dass du dagegen bist. Je mehr dagegen sind, desto mehr steigen die Aktien.»
Doch am nächsten Abend verbrüderten sie sich wieder, als wäre nichts geschehen.
Dann erzählte Hansruedi von seinem Basler Götti, der den halben Dreispitz besessen habe. Zur Hochzeit habe dieser ihm einen Läufer geschenkt, dessen Länge der Breite länger war als die Länge – ein Monster von einem Teppich, den man über zwei WB-Güterwagen legen musste. «In dr Spitzbergkurve hei si müesse uffpasse, dass er nid knickt!»
Dann wandte er sich treuherzig an Eugen Gentsch, der bei der Waldenburgerbahn arbeitete: «Eugen, kannst du nicht nachschauen, ob der Frachtbrief noch vorhanden ist?» Während sich die Runde kringelte vor Lachen, blieb Hansruedi todernst.
Eine weitere Tradition des Jägerli war die Wildsau, die Glutz Hans jeweils im Herbst erstand und mindestens zwei Tage lang draussen zur Schau stellte, bevor er den Wildsaupfeffer zubereitete. Wir Kinder beobachteten die starren Augen des Tiers mit heimlichem Grauen – die Erwachsenen hingegen schienen sich nicht daran zu stören. Niemand wurde jemals krank. Das Lebensmittelinspektorat war offenbar kein Fan des Pfeffers – oder einfach wohlgesinnt.
Zu später Stunde kam es regelmässig zu musikalischen Einlagen. Vater Lipp intonierte «Ich bin vom Gotthard, der letzte Postillon», während Krattiger Max nur dann «s Gugger-Zytli» sang, wenn im Jägerli absolute Stille herrschte. Dann konnte er sein Publikum in ehrfürchtiges Schweigen versetzen – bevor er zum Abschluss eine Flasche Ziegelhof entgegennahm.
So vergingen die Abende im Jägerli. Es wurde gelacht, gestritten, gesungen und getrunken. Und wenn Glutz Hans um Mitternacht wieder seine Boxbewegungen machte und «Boxclub Derendingen!» brüllte, wusste jeder: Die Welt war in Ordnung.

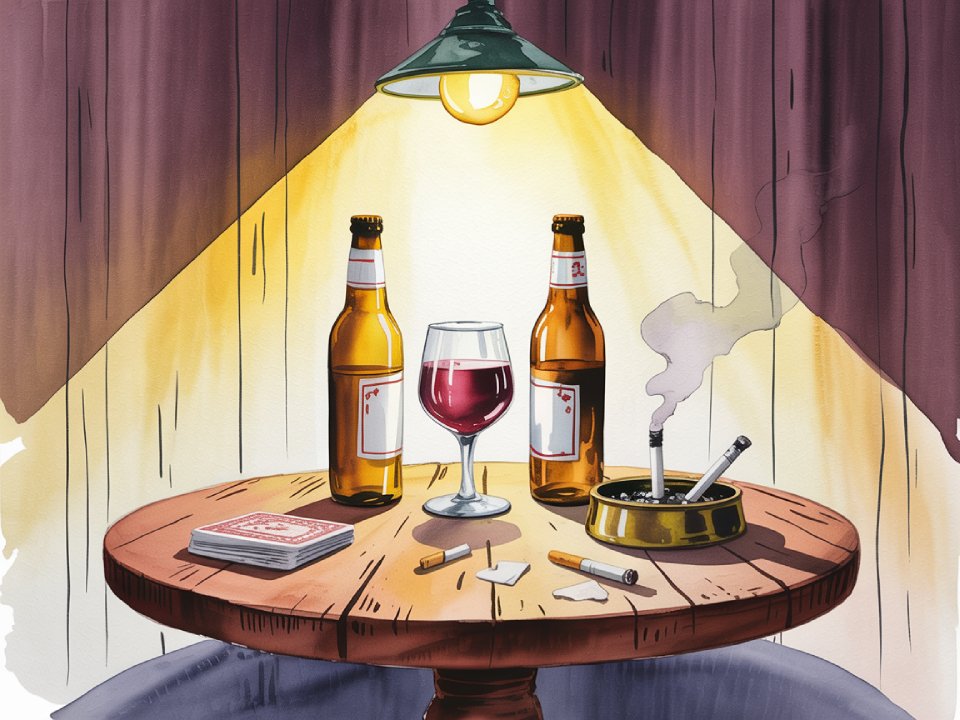





Phantastisch Hanspeter……. Genauso ha ich das in de 70er au mängisch erläbt Zum ganze het ame no dr Bündnerseppi siner Meinig in dr Bierseeligkeit kund do und Meinardi Päuli het drzue mit de Ohre gwagglet!!!
Ich ha grad under dr Stube vom Glutz Hans my ZImmer gha und….. er het denn ame s Fänschter ufgrisse und dr Löter Fritz verbal liebkost!
Bravo, e tolli Gschicht
Ich musste beim Lesen deines Kommentars richtig schmunzeln – so viele Erinnerungen an die 70er, einfach herrlich. Der Bündnerseppi mit seinen Sprüchen in der Bierseligkeit und wie Meinardi Pauli dazu mit den Ohren gewackelt hat – ein Bild, das sofort lebendig wird!
Leider konnte ich die Zeit mit Glutz Hans nicht live miterleben – da war ich schlicht noch zu jung. Aber bei Lohners – bei deinen Eltern – durfte ich später natürlich auch ein Stück dieser besonderen Atmosphäre schnuppern. Und die war wirklich nicht ohne!
Herzlichen Dank für deine wunderbare Erinnerung – solche Geschichten machen das Leben doch bunt und unvergesslich!