Es gibt Dinge, die leuchten aus einer Schublade heraus, auch wenn Jahrzehnte vergangen sind.
Eine Ansichtskarte zum Beispiel, vergilbt am Rand, die Schrift mit Füllfeder geschrieben, die Tinte längst etwas verlaufen. Man schlägt sie zufällig zwischen alten Papieren auf – und plötzlich ist man wieder in jener Zeit. Der Poststempel verrät das Jahr, ein Ferienort taucht auf, eine hastig gekritzelte Grussformel, und vorne auf der Karte prangt ein Bild, das damals das Schönste war, was man nach Hause schicken konnte.
Diese kleinen Kartonkärtchen gehörten für Generationen zum Alltag. Sie waren Erinnerung, Botschaft und Schmuck zugleich. Für viele Familien, in deren Stuben die Mittel für «echte» Kunst fehlten, war die Ansichtskarte die erste Galerie.
Ein alter Text mit brennender Aktualität
Im Jahr 1907 veröffentlichte der Schriftsteller Jules Coulin in der Berner Rundschau einen Artikel mit dem Titel Volkskunst und Ansichtskarten. Er nannte die Karte das «Museum des Volkes». Ein starkes Bild: Während Gemälde in den Museen hingen, zu denen viele gar keinen Zugang hatten, flatterten die Karten in jedes Haus.
Coulin war hin- und hergerissen. Einerseits sah er in den bunten Karten eine «Scheinkunst» voller Übertreibungen, oft grell koloriert, verzerrt und geschmacklich fragwürdig. Andererseits erkannte er darin ein Bedürfnis: Wer in einer dunklen, eintönigen Welt lebte, nahm mit Freude jede Farbe, jeden Glanz, jedes Bild von Ferne auf.
Er forderte, dass man das Schönheitsbedürfnis der Menschen ernst nehmen müsse. Statt sie mit billigen, überladenen Karten abzuspeisen, sollte man ihnen gute Reproduktionen bieten, hochwertige Lichtdrucke, Bilder, die nicht nur oberflächlich gefielen, sondern das Auge und das Gemüt schulten.
Wenn man seinen Text heute liest, staunt man: Schon damals wurde darüber gestritten, ob die Karte Kitsch sei oder echte Volkskunst. Und gleichzeitig klingt sein Plädoyer nach, dass Volkskunst nicht bloss in geschnitzten Bauernschränken oder Stickmustern stecken dürfe, sondern auch in den unscheinbaren Dingen des Alltags.
Volkskunst im Alltag
Was aber ist Volkskunst? Die Volkskunde hat darauf nie eine endgültige Antwort gefunden. Für die einen ist es die bemalte Truhe, das Zinnkrüglein, der geschnitzte Herrgottswinkel. Für andere sind es gerade jene alltäglichen Dinge, die in Massen kursierten, die aber trotzdem Gefühle bündelten: das Abziehbild, der Wandkalender, die Postkarte.
Ansichtskarten erfüllten gleich mehrere Funktionen. Sie waren ein Gruss – «Herzliche Grüsse aus Davos» –, sie waren Erinnerung – «Das war unser Hotel am Bodensee» – und sie waren Schmuck: man steckte sie hinter den Spiegel, heftete sie an den Schrank oder sammelte sie in einem Album.
Vor allem aber machten sie die Welt ein Stück grösser. Wer im Baselbiet lebte, bekam vielleicht eine Karte aus Rom oder vom Bodensee. Plötzlich war das, was man nur aus Erzählungen kannte, in Bildform da.
Heimatbilder
Genauso wichtig war aber die andere Richtung: die Karten, die das Nahe zeigten. Jede Gemeinde hatte ihre Dorfansichten, fotografiert und auf Karton gedruckt. Häuserzeilen, Kirchtürme, Bahnhöfe. Solche Karten sind heute kostbare Zeitzeugen: Sie zeigen Strassen, die längst anders aussehen, Häuser, die verschwunden sind, eine Landschaft, die sich verändert hat.
Gerade hier wird die volkskundliche Dimension sichtbar: Ansichtskarten prägten unser Bild von Heimat. Sie stellten dar, was man für zeigenswert hielt. Der Dorfplatz, die Kirche, die Fabrik – alles wurde in Szene gesetzt. So wuchs im Alltag ein kollektives Bildgedächtnis.
Von der Postkarte zum Instagram-Post
Heute haben die Ansichtskarten ihre Rolle fast verloren. Wer in die Ferien fährt, schickt ein Bild über WhatsApp oder stellt es auf Instagram. Die Funktion ist die gleiche: Man zeigt, wo man ist, man teilt eine Erinnerung, man will jemandem nahe sein.
Doch etwas fehlt: Die Karte konnte man anfassen. Sie lag im Briefkasten, sie kam überraschend, man konnte sie aufbewahren. Digitale Bilder rauschen im Strom vorbei, während eine alte Ansichtskarte, die plötzlich wieder auftaucht, eine Zeitreise möglich macht.
Volkskundlich gesehen sind auch die Instagram-Bilder nichts anderes als die Fortsetzung der Postkarte mit anderen Mitteln. Es bleibt die Volkskunst des Alltags – Bilder, die in die Welt geschickt werden, bunt, kitschig, manchmal auch kunstvoll.
Zwischen Kitsch und Kunst
Jules Coulin hatte recht: Ansichtskarten waren oft überladen und billig gemacht. Aber gerade darin liegt ihre Bedeutung. Sie zeigen, was Menschen mochten, was sie bewegte, wovon sie träumten. Volkskunst war nie nur «edel», sie war auch einfach, direkt, manchmal grob.
Darum lohnt es sich, diese Karten zu sammeln, zu betrachten und ernst zu nehmen. Sie sind Zeugnisse einer Kultur, die von unten kommt – nicht aus den Ateliers der Maler, sondern aus den Händen der Schreibenden und Empfangenden.
Volkskunst zeigt sich nicht nur in Museen. Sie lebt im Alltag, in den kleinen Dingen, die unser Leben begleiten. Die Ansichtskarte war über Jahrzehnte hinweg eine dieser Formen. Sie brachte Bilder von Heimat und Ferne ins Haus, sie war Gruss und Schmuck, Kitsch und Kunst zugleich.
Vielleicht liegt ihre Kraft gerade darin, dass sie unscheinbar ist. Man kann sie in einer Schublade vergessen – und Jahrzehnte später weckt sie Erinnerungen, als wären sie gestern gewesen.
So bleibt sie ein Stück Volkskunst, das verbindet: Generationen, Orte, Erinnerungen. Und vielleicht liegt in jeder alten Karte auch die stille Botschaft: Die Welt ist grösser, bunter und voller Geschichten, als wir im Augenblick glauben.




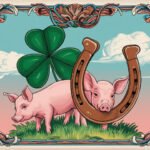


0 Kommentare