Es gibt Tage im Kirchenjahr, die leuchten nicht mit dem Glanz festlicher Freude, sondern mit dem warmen Licht einer stillen Erwartung. Der Palmsonntag ist so ein Tag.
In seiner liturgischen Würde steht er am Eingang zur Karwoche – jener dichten Zeit zwischen Licht und Dunkel, Tod und Auferstehung. Und er trägt in sich nicht nur den biblischen Ernst, sondern auch die farbige Vielfalt jahrhundertealter Bräuche, Anekdoten und Symbole.
Ursprung und Bedeutung
Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem – hoch zu Esel. Die Menschen begrüssten ihn mit Palmzweigen und jubelten «Hosanna dem Sohn Davids!» (Mt 21,1–11). Doch es war ein stiller König, der hier kam: kein Feldherr auf einem Ross, sondern ein Friedensbringer auf einem Lasttier.
Bereits im 4. Jahrhundert ist belegt, dass man in Jerusalem eine Palmenprozession feierte, die diesen Einzug liturgisch nachstellte. Die Gläubigen trugen Palmzweige oder – in Mitteleuropa – Weiden und Buchsbaum, und begleiteten einen Christusdarsteller bis zur Kirche. Ein Sinnbild für Hoffnung und den Glauben an eine kommende Wandlung.
Der Palmesel – Zwischen Kult und Komödie
Aus dieser liturgischen Handlung entwickelte sich im Mittelalter der Palmesel, eine kunstvolle, oft hölzerne Darstellung von Christus auf einem Esel. Dieses auf Rädern montierte Requisit wurde in vielen Regionen – auch in der Schweiz – an Palmsonntag feierlich durch das Dorf oder bis in die Kirche gezogen. Man sah es als Gnade an, wenn man den Palmesel ziehen durfte, manche Gemeinden versteigerten sogar das Zugrecht zugunsten der Kirche.
In der Chronica Cygnea berichtet Tobias Schmid:
«Am Palmsonntag haben sie einen hölzernen Esel mit grossem Jubelgeschrey in die Kirche gezogen. Etliche, die guten Vermögens gewesen, haben viel Gelt drauff gewendet…»
Noch heute sind einige dieser Palmesel erhalten, etwa im Historischen Museum Basel oder im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich.
Spöttische Episoden aus der Schweiz
Einige überlieferte Anekdoten werfen ein augenzwinkerndes Licht auf die einstige Bedeutung des Palmesels – und auf das Spannungsfeld zwischen katholischem Brauchtum und reformiertem Spott:
- Ehrendingen (AG): Dort stand ein ausgedienter Palmesel lange unbeachtet, bis ihn die Dorfbewohner zum «Heiligen» erklärten. Sie sägten Vorder- und Hinterteil ab und stellten das Mittelstück – Christus darstellend – in eine Mauernische der Kirche. Die reformierten Wehntaler, die regelmässig daran vorbeizogen, sparten nicht mit Spott, worauf die Figur wieder entfernt wurde.
- Bremgarten (AG): Bei einer Prozession stürzte der Palmesel auf dem Pflaster, verlor seinen Schwanz – worauf der würdige Schultheiss den Schwanz kurzerhand in den Mund nahm, um den Leim zu befeuchten, und ihn wieder an Ort und Stelle setzte. Volksfrömmigkeit mit Improvisationstalent.
Historisch gesichert sind diese Anekdoten nicht – sie stammen aus dem liebevoll-humorvollen Beitrag von Jos. Amstalden aus der Zürcher Illustrierten von 1930. Doch sie passen gut in eine Zeit, in der Glaube, Ritual und Lebensnähe noch keine Gegensätze waren.
Reformation und Abschaffung
Mit der Reformation verschwanden viele dieser Bräuche. In Zürich wurde 1522 der Palmesel aus der Peterskirche entfernt, und 1524 die Prozession offiziell verboten. Reformatoren wie Zwingli und Bullinger kritisierten kultische Darstellungen ohne klare biblische Grundlage als «Götzendienst».
Interessant: Noch Jahrzehnte später musste der Pfarrer von Zürich den Metzgern, die einst den Palmesel zogen, am Aschermittwoch einen Fastnachtskuchen schenken – ein letzter Nachhall des alten Brauches.
Die Zweige der Hoffnung
Trotz aller Umbrüche hat sich der Palmsonntag in seiner symbolischen Kraft erhalten: Die gesegneten Zweige, die man nach Hause bringt und übers Jahr hinter das Kruzifix steckt, gelten vielerorts noch heute als Schutz- und Segenszeichen. In katholischen Gegenden werden sie zu Asche verbrannt – für den Aschermittwoch des nächsten Jahres. Der Kreislauf beginnt von neuem.
Zwischen Frömmigkeit und Volkskultur
Der Palmsonntag zeigt eindrücklich, wie sich Glaube und Volkskultur einst verbanden: mit Bildern, Symbolen, auch mit Lachen und Missgeschicken. Er war nie nur Liturgie – er war auch lebendige Lebenskunst.
Vielleicht ist das sein Geheimnis: Er mahnt zur Stille, aber nicht zur Schwere. Er kündet vom Kommenden – dem Leiden, dem Sterben – aber auch von einer Kraft, die durchträgt. Und vielleicht braucht es in unserer Zeit gerade diese Erinnerung an eine Frömmigkeit, die auch mal den Schwanz des Esels wieder anklebt und darüber lacht.
Quellen & Hinweise
- Jos. Amstalden: Vom Palmsonntag, in: Zürcher Illustrierte, 1930, Nr. 15
- Otto Birlinger: Volkstümliches aus Schwaben, Freiburg 1874
- Josef Andreas Jungmann: Missarum Sollemnia, Freiburg 1951
- Heinrich Bullinger: Tigurinerchronik, Zürich 1577
- Wilhelm Mannhardt: Wald- und Feldkulte, Berlin 1875




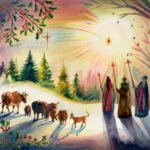


0 Kommentare