Wenn die Tage länger werden, das erste zarte Grün sich zeigt und die Luft nach Neubeginn duftet, dann beginnt eine besondere Zeit im Jahr: Ostern.
Es ist ein Fest, das wie der erste Sonnenstrahl nach langer Nacht das Innerste berührt – still, leuchtend, verheissungsvoll. Ein Lichtfest, das seit Jahrtausenden den Sieg des Lebens über den Tod, des Lichts über das Dunkel, des Anfangs über das Ende feiert.
Ein Name, der von alten Göttinnen erzählen könnte
Der Name Ostern klingt geheimnisvoll – und trägt möglicherweise Spuren uralter Mythen in sich. Der angelsächsische Mönch Beda Venerabilis berichtet im 8. Jahrhundert von einer Frühlingsgöttin namens Eostre, zu deren Ehren im Frühling Feste gefeiert worden seien. Ob diese Göttin wirklich verehrt wurde oder eher ein poetisches Symbol für den Neubeginn ist, bleibt offen – doch der Gedanke an eine uralte Licht- und Fruchtbarkeitsgöttin schwingt in vielen Osterbräuchen bis heute mit.
Das Licht aus dem Osten – Sinnbild für Aufbruch
Nicht zufällig liegt der Osten dem Namen nach Ostern zugrunde: Dort geht die Sonne auf, dort beginnt der Tag, dorther kommt das Licht. In vielen Kulturen steht der Osten für Geburt, Erneuerung, Segenskraft. Im christlichen Glauben verbindet sich diese Himmelsrichtung mit der Auferstehung – mit jenem Wunder, das den Tod nicht leugnet, sondern verwandelt.
Vom Ei zur Welt – die Symbole des Werdens
Der Hase, das Ei, das frische Grün – sie alle erzählen vom Leben, das sich Bahn bricht. Der Hase mit seiner Fruchtbarkeit, das Ei als Schale des Neubeginns, das Pflanzenwachstum als Gleichnis der Hoffnung. In Mythen vieler Völker ist das Ei sogar Ursprung der Welt.
Wenn wir heute Ostereier färben, knüpfen wir – meist unbewusst – an diese Symbolsprache an. Jede Farbe, jedes Muster hat einst gedeutet, gedeutet, was kommen möge: Glück, Liebe, Fruchtbarkeit. Was kindlich verspielt erscheint, war einst ein ritueller Akt.
Kräuter, Wasser, Feuer – die Sprache der Natur
Mit dem Osterfest lebt auch die uralte Verbindung zur Natur auf. Das Kräutersammeln im Frühling, das Osterwasser, das bei Sonnenaufgang schweigend geschöpft wird, oder das Osterfeuer – all diese Rituale verknüpfen christliche und vorchristliche Weltsicht.
Pflanzen gelten in diesen Tagen als besonders heilkräftig, durchdrungen vom Licht des Ostens. Wasser, das in der Dämmerung geschöpft wird, soll Schönheit, Heilung und Schutz schenken. Feuer, das in der Osternacht entfacht wird, symbolisiert das Licht, das aus der Dunkelheit geboren wird.
Ostern im Rhythmus der Gestirne
Der Ostertermin richtet sich bis heute nach den Himmelsläufen: Ostern fällt auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der Frühlingstagundnachtgleiche. Diese Regel, 325 beim Konzil von Nicäa beschlossen, ist kein Zufall – sondern Ausdruck jener tiefen Verbindung zwischen Fest und Natur, Himmel und Erde.
Besonders schön zeigt sich dies im Schwarzdorn, der vielerorts zur Osterzeit blüht. Nach dem langen Winter entfaltet er seine weissen Blüten – als erstes grosses Versprechen der Natur: Es wird wieder Leben geben.
Von alten Bräuchen und neuer Bedeutung
Mit der Ausbreitung des Christentums wurde vieles übernommen und neu gedeutet. Die heidnischen Frühlingsfeste verwoben sich mit der Auferstehungsbotschaft. Der Lichtbringer wurde zum Lebensspender – Jesus Christus als neues Zentrum einer alten Symbolik.
Diese synkretistische Verbindung ist bis heute spürbar. Ostern ist ein Fest des Übergangs – vom Alten zum Neuen, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, von der Erde zum Himmel.
Ein bewusster Neubeginn
In einer Welt, in der Feiertage oft zur Nebensache werden, lädt uns Ostern ein, innezuhalten. Nicht bloss, um Traditionen zu wiederholen, sondern um zu spüren: Was will in mir wachsen? Welche Saat lege ich in dieses Jahr?
Vielleicht heisst das, still ein Ei zu bemalen – mit einem Wunsch darin. Oder am Morgen barfuss durchs taufrische Gras zu gehen. Oder einfach dem Licht zuzusehen, wie es sich durchsetzt.
Denn das ist Ostern: kein Ereignis – sondern ein Erwachen.




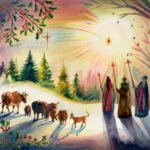


0 Kommentare