Es gibt Tage, die verändern sich mit den Jahren. Sie verlieren ihr Äusseres – und gewinnen an Innerem. Der Karfreitag ist für mich ein solcher Tag.
Früher war er mir fremd. Still, streng, leer. Ein Feiertag ohne Farbe. Doch mit der Zeit begann ich, ihn anders zu sehen. Nicht, weil sich der Tag verändert hätte – sondern weil sich mein Blick verändert hat. Heute ist er mir ein Tag der Sammlung. Einer, der mich einlädt, still zu werden. Und hinzuhören – auf das, was leise spricht.
Ein Name, der nach innen führt
Der Name Karfreitag stammt vom althochdeutschen kara – Trauer, Klage, Schmerz. Dieser stille Feiertag verweist auf das Kreuz Jesu, auf Leiden und Tod. Doch er erschöpft sich nicht in Schwermut. Vielmehr führt er uns in eine Tiefe, in der Trauer nicht erstickt, sondern verwandelt wird – in Mitgefühl, Nachdenklichkeit und Hoffnung.
Der Karfreitag ist der tiefste Punkt der Karwoche – und zugleich ein Wendepunkt. Er macht uns empfänglich für das, was über das Sichtbare hinausgeht.
Evangelische Tradition: Stille als Zeichen der Würde
In den reformierten Kirchen gilt der Karfreitag als einer der bedeutendsten Feiertage. Die Gottesdienste sind schlicht, getragen von Stille, Gebet und Passionsmusik. Die Worte sind gewählt, der Ton zurückhaltend. Kein Prunk – dafür Raum für das Wesentliche: das Kreuz.
Wenn Paul Gerhardts Choral «O Haupt voll Blut und Wunden» oder Bachs Passionen erklingen, spürt man, wie Musik das Unaussprechliche ausdrückt. Sie durchdringt die Stille nicht, sie vertieft sie.
Für viele Jugendliche ist der Karfreitag auch ein Übergangsritus: Wer am Palmsonntag konfirmiert wurde, tritt am Karfreitag zum ersten Mal eigenständig zum Abendmahl. Ein stiller, feierlicher Schritt ins eigene Glaubensleben.
Katholische Liturgie: Das Schweigen spricht
Auch in der katholischen Kirche ist der Karfreitag ein Tag des Verzichts. Keine Messe, kein Glockenläuten, keine Orgel. Stattdessen: Schweigen, Reduktion, Ernst.
Zentrum der Liturgie ist die Kreuzverehrung: Das Kreuz wird enthüllt, Gläubige treten heran, berühren es, beugen sich, küssen es. Jede Geste ist ein stilles Bekenntnis. Danach wird vielerorts das Heilige Grab aufgebaut – mit Blumen, Kerzen und Bildern. Ein Ort der Andacht, des Verweilens. Vielleicht auch ein Ort für Tränen.
Ostkirche: Erlebte Passion
Die orthodoxen Kirchen gestalten die Karwoche mit grosser Eindringlichkeit. Alles ist durchwirkt von Symbolik, Klang und Dichte. Die Passion Christi wird nicht nur erzählt, sondern miterlebt – mit Herz und Sinnen.
Ein Hymnus der Ostkirche verdichtet diese Erfahrung in kraftvollen Bildern:
Als du ins Grab gelegt wurdest,
hast du die in den Gräbern Wohnenden auferweckt,
Unsterblichkeit und Leben dem Menschengeschlecht geschenkt.
Es ist ein Gebet, eine Klage und eine Hoffnung in einem – getragen von der Zuversicht, dass selbst der Tod nicht das letzte Wort hat.
Eine Schweizer Initiative: Der Arzt aus Appenzell
Dass der Karfreitag in der reformierten Schweiz ein offizieller Feiertag wurde, ist nicht selbstverständlich. Erst im 19. Jahrhundert setzte sich der Appenzeller Arzt und Palästinaforscher Titus Tobler dafür ein. Sein Anliegen: ein gemeinsamer Gedenktag, der die Kantone verbindet – im Zeichen der Passion Christi.
Die erste gesamtschweizerische Kirchenkonferenz wurde 1858 in Zürich einberufen. 1861 war der Karfreitag im Kalender verankert. Ein Zeichen dafür, dass auch Stille gemeinsame Kraft entfalten kann.
Was dieser Tag schenken kann
Der Karfreitag ist ein stiller, aber kraftvoller Tag. Er unterbricht das Gewohnte. Stellt Fragen, wo sonst Antworten erwartet werden. Er erinnert an das Leiden – aber nicht, um uns zu entmutigen. Sondern um uns die Tiefe der Menschlichkeit zu zeigen.
Und vielleicht ist es genau das, was dieser Tag lehrt: dass in der Dunkelheit ein Leuchten wartet. Nicht laut. Nicht sofort. Aber da – wie das Osterlicht hinter dem Horizont.




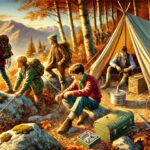


0 Kommentare