Nichtregierungsorganisationen – das klingt nach Engagement, nach ursprünglicher Bürgerkraft. Doch in der Schweiz, wie anderswo, zeigt sich zunehmend eine Verschiebung: Weg vom Ehrenamt, hin zu Organisationen mit beträchtlicher finanzieller Abhängigkeit vom Staat – und mit Einfluss, der weit über blosses Lobbying hinausgeht.
Ursprünglich waren NGOs dafür da, Missstände anzuprangern, politisches Bewusstsein zu fördern, die Politik zur Rechenschaft zu ziehen. Doch heute übernehmen manche NGOs Aufgaben, die der Staat früher selbst verrichtete – oder zumindest streng reguliert hätte.
Klassische Beispiele: Beratung von Asylsuchenden, Bildungsarbeit, Rechtsverfahren, Meldestellen. NGOs werden zu Gatekeepern, wenn sie entscheiden, wer Hilfe bekommt, wer Zugang zu Bildung hat, wer in öffentlichen Debatten mitreden darf.
Direkte Subventionen: Wenn der Staat zahlt, wessen Agenda zählt?
Damit Kritik nicht auf Vermutungen basiert, hier ein paar konkrete Fälle:
- Caritas Schweiz und Rotes Kreuz Schweiz: Beide erhalten vom Bund erhebliche Mittel über DEZA und über Leistungsaufträge im humanitären Bereich. 2020 etwa über 60 Millionen CHF in diversen Formen der Förderung. Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)
- NGO-Kernbeiträge der DEZA: Im Rahmen internationaler Zusammenarbeit stellt die Schweiz für die Periode 2025–2026 etwa 235 Millionen CHF bereit für Schweizer NGOs. Diese Gelder dienen zur Finanzierung von Projekten wie Berufsbildung, Menschenrechten oder Klimaschutz. Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)+1
- Solidar Suisse arbeitet vielfach im Auftrag des Bundes, z. B. bei Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Ohne staatliche Mittel wären viele ihrer Programme nicht durchführbar. Wikipedia
- AHV-Subventionen für NGOs in der Alterspolitik: Über das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) werden gesamtschweizerisch tätige gemeinnützige Nichtregierungsorganisationen unterstützt, die Aufgaben in der Alters- und Generationenpolitik übernehmen. BSV
Diese Beispiele zeigen: Der Staat finanziert NGOs nicht nur in Randbereichen, sondern zunehmend in zentralen Politikfeldern.
Wirkung im Alltag: Macht ohne Wahlurne?
Wenn man sieht, wie viel Geld fliesst, ist der nächste Schritt, genauer hinzuschauen:
- Zweckgebundenheit und Agenda
Viele Fördermittel sind nicht «frei verfügbar»: Sie sind an Programme, Ziele oder Themen gekoppelt, die der Bund oder andere Behörden vorgeben – etwa Entwicklungszusammenarbeit, Integration, Klimapolitik. NGOs, die solche Aufgaben übernehmen, müssen sich also an staatlich definierte Rahmen halten – was grundsätzlich legitim ist, aber gleichzeitig ihre Unabhängigkeit einschränkt. - Demokratische Legitimation und Kontrolle
Anders als Parlamente oder Behörden werden NGOs nicht gewählt. Bürgerinnen und Bürger können NGOs nicht abwählen. Transparenz ist nicht durchgehend vorhanden: Welche NGO erhält wieviel Geld wofür? Wie werden Ergebnisse gemessen? Welche Nebenwirkungen gibt es? Einige Vorstösse im Parlament fordern mehr Transparenz bei NGO-Finanzierung. Parlament+2Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)+2 - Grenzen des Staates vs. Aufgabe der Zivilgesellschaft
Manche Zuständigkeiten sind eigentlich Staatssache – etwa Schutzrechte, Rechtsberatung bei Migration oder Asyl, Menschenrechte. Wenn NGOs diese Aufgaben übernehmen, verschiebt sich woanders die Verantwortung – oft ohne klare Regelungen darüber. - Effekt auf Meinungsvielfalt
Wenn Fördermittel vorrangig Organisationen mit bestimmten politischen Winkeln erhalten – z. B. NGOs mit spezifischen Ansichten zu Migration, Klima, soziale Gerechtigkeit – kann das zu einer Verzerrung führen, weil alternative Perspektiven weniger Unterstützung bekommen. Nicht jedes Förderprojekt ist neutral.
Ein differenzierter Blick
Natürlich gibt es auch gute Gründe, warum der Bund mit NGOs zusammenarbeitet:
- Effizienz: NGOs haben oft Spezialwissen, Netzwerke, lokale Präsenz, die der Staat nicht so einfach aufbauen kann.
- Innovation: Viele Projekte beginnen als NGO-Initiativen und zeigen neue Lösungswege.
- Vertrauen: In manchen Regionen oder Bereichen haben NGOs mehr Glaubwürdigkeit als staatliche Stellen.
Aber gerade deshalb braucht es Regeln, damit solche Kooperationen nicht zur intransparenten Machtübernahme werden.
Vorschläge für Reformen
Damit Demokratie und bürgerliche Kontrolle gewahrt bleiben, könnten folgende Massnahmen helfen:
| Reformpunkt | Bedeutung |
| Volle Offenlegung der Gelder | Jede NGO, die vom Bund, Kanton oder Gemeinde substantiell finanziert wird, sollte offenlegen, wieviel Geld sie bekommt, wofür, mit welchen Zielen und welchen Ergebnissen. |
| Klare Aufgabentrennung | Welche Aufgaben sind grundlegend vom Staat wahrzunehmen? Welche sind Zusatzaufgaben, die zivilgesellschaftlich sein dürfen? Eine gesetzliche oder verfassungsmässige Abgrenzung wäre sinnvoll. |
| Verbindliche Neutralitätsklauseln bei Subventionen | Staatliche Förderung sollte nicht an explizite Ideologien gekoppelt sein – oder wenn doch, muss dies offen sein und demokratisch legitimiert. |
| Stärkere parlamentarische Kontrolle | Nicht nur das Budget, sondern auch Zweckbindung, Wirksamkeit und Kosten-Nutzen von NGO-Aufträgen sollten parlamentarisch überprüfbar sein. |
Der NGO-Komplex ist kein abstraktes Schlagwort. In der Schweiz wird Demokratie zunehmend durch Strukturen beeinflusst, die nicht gewählt sind, aber grosser finanzieller Abhängigkeit unterliegen – und doch politischen Einfluss ausüben.
Der Staat darf nicht zum Sponsor ideologischer Missionen werden, ohne dafür rechenschaftspflichtig zu sein. Wer Demokratie will, muss Vielfalt erlauben – nicht Meinungseinheit durch Subventionen.


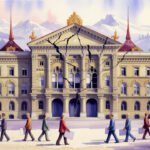


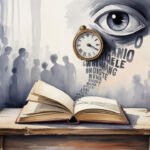

0 Kommentare