Der Auffahrtstag, auch bekannt als Christi Himmelfahrt, ist einer jener Feiertage, die uns mitten in der Woche innehalten lassen.
Ein Donnerstag im Mai oder Juni, gelegen zwischen Ostern und Pfingsten, der gleichermassen religiöse Tiefe und altes Brauchtum vereint. In der Schweiz ist er nicht nur kirchlicher Feiertag, sondern auch ein Tag der Ausflüge, Umritte, ländlichen Feste und stillen Traditionen. Wer sich auf die Spur dieses besonderen Tages begibt, entdeckt einen reichen Schatz an Geschichte, Volkskultur und Naturerfahrung.
Religiöse Wurzeln: Christi Himmelfahrt als Vollendung
Biblisch betrachtet ist Auffahrt der 40. Tag nach Ostern. Jesus, der am dritten Tag nach seiner Kreuzigung auferstanden war, kehrt an diesem Tag zu seinem Vater in den Himmel zurück. Lukas und Markus berichten von dieser Himmelfahrt, und bereits der Kirchenlehrer Augustinus erwähnte sie als christlichen Feiertag. Auffahrt bedeutet nicht nur Abschied, sondern auch Vollendung: Die Auferstehung findet ihren Abschluss in der Heimkehr zu Gott. Die Theologie spricht von der Erhöhung Christi und seiner Wiedervereinigung mit dem Vater. In dieser Perspektive wird Auffahrt zur Brücke zwischen dem Irdischen und dem Himmlischen, zwischen dem Osterjubel und dem Pfingstgeist.
Heidnische Überlagerungen: Wenn die Sonne in drei Sprünge aufgeht
Doch wie so oft in der christlichen Festkultur reichen die Wurzeln tiefer. Vieles, was wir heute an Auffahrt feiern, hat seinen Ursprung in vorchristlichen Frühjahrsritualen. Flurbegehungen, Bittgänge und das Besteigen von Höhen waren schon bei Kelten und Germanen verbreitet. Man wollte die Fruchtbarkeit der Felder sichern, die Geister günstig stimmen oder den Göttern danken. Der christliche Kalender übernahm diese Rituale und gab ihnen neue Bedeutungen. So wurde aus dem heidnischen Feldgang der kirchliche Prozessionsumritt.
Der Brauch, an Auffahrt auf Höhen zu steigen – etwa auf den Uetliberg, die Scheidegg oder den Pfannenstiel – geht auf solche heidnische Sonnenverehrung zurück. Man wollte den Sonnenaufgang erleben, der an diesem Tag in «drei Sprünge» aufgehen sollte. Selbst Kirchenlehrer rügten früher, dass sich das Volk zuerst vor der Sonne verbeuge, bevor es zur Predigt in die Kirche ging. Ein wunderbares Zeugnis für die tief verwurzelte Naturverbundenheit unserer Vorfahren.
Der Auffahrtstag in der Volkskultur: Beromünster, Maienfeld und Liestal
Zu den eindrücklichsten Auffahrtsbräuchen zählt der Umritt in Beromünster, der bereits im 14. Jahrhundert urkundlich erwähnt wird. Bis heute ziehen berittene Prozessionen, begleitet von Musik und feierlichem Glockengeläut, durch das Luzerner Hinterland. Die Stiftskirche wird zum Zentrum eines jahrhundertealten Rituals, bei dem eine mit Blumen geschmückte Christusfigur zur Kirchendecke emporgezogen wird. In Sempach, Grosswangen, Ettiswil und anderen Orten haben sich ähnliche Formen erhalten, alle mit tiefer symbolischer Kraft.
Auch der Banntag in Liestal, jeweils am Montag vor Auffahrt, gehört zum lebendigen Brauchtum. Ursprünglich eine Grenzbegehung mit Segenscharakter, ziehen die Bürger mit Musik, Schüssen und Maienhüten in vier Richtungen hinaus. In Celerina, im Oberengadin, findet man bis heute sommerliche Bannumgänge – mit exakt abwechselnder Umrundung der rechten und linken Talseite.
Und dann gibt es Maienfeld. Auf der Luziensteig, vor der Kulisse des Falknis, versammelt sich das Volk zum Gottesdienst unter freiem Himmel. Die kleine Steigkirche kann die Menschenmenge kaum fassen. Nach der Predigt beginnt das Volksfest mit Nusstorten, Rotwein und Kindergesang. Was hier gefeiert wird, ist nicht nur ein kirchlicher Feiertag, sondern ein sinnliches, generationenverbindendes Gemeinschaftserlebnis.
Vom Wallfahrtszug zur Wanderfreude: Moderne Formen eines alten Festes
Heute hat sich vieles verändert. Die berittenen Umritte sind seltener geworden, der Kirchgang ist nicht mehr selbstverständlich. Doch die Kraft des Tages ist geblieben. Viele nutzen Auffahrt für eine Wanderung, eine Radtour oder einfach zum Innehalten. Die alten Bedeutungen wirken weiter, auch wenn sie sich verändert haben. Der Gang in die Natur, der Aufstieg auf einen Aussichtspunkt, das Erleben von Weite und Licht – all das bleibt eine Form moderner Himmelfahrt.
Besonders eindrücklich sind die Bilder der frühen Morgenstunden, wenn Menschen in stiller Andacht dem Sonnenaufgang entgegensehen. Wenn Kinder barfuss über taunasse Wiesen laufen. Wenn Familien picknicken, wo einst Pilger beteten. In solchen Momenten wird spürbar, was dieser Tag meint: nicht Flucht aus dem Alltag, sondern ein Blick darüber hinaus.
Himmelwärts denken, bodenständig bleiben
Der Auffahrtstag ist ein Tag der Verbindung. Zwischen Glauben und Brauchtum, zwischen alten Riten und neuer Freizeitkultur, zwischen Himmel und Erde. Wer sich ihm mit offenen Sinnen nähert, findet mehr als einen freien Tag: eine Einladung zum Staunen, zum Erinnern und vielleicht auch zum Weitertragen.
In einer Zeit, in der vieles flüchtig ist, erinnern uns diese alten Feste an etwas Bleibendes: an unsere Verortung in Zeit und Raum, in Geschichte und Natur. Und vielleicht ist das das schönste Geschenk, das uns die Auffahrt heute noch macht.


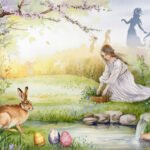




Eine wunderbare Würdigung eines Festtages, umfassend beleuchtet.
Leider gibt es immer wieder staatliche Tendenzen, religiöse Festtage zu streichen. Und dabei empfinde ich sie auch als so wohltuend, um zu entschleunigen und dem Brauchtum die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken.
Wie immer lese ich gerne hier und lasse herzliche Grüße da, C Stern
Guten Morgen Hanspeter
Liebe Grüsse aus Split. Peter