Man sagt, dass die Faulheit eine Todsünde sei. Aber vielleicht ist es an der Zeit, dieses Urteil zu überdenken. Zumindest dann, wenn wir unter Faulheit nicht Lethargie oder Apathie verstehen, sondern das bewusste Nichtstun, das absichtslose Dasein, das Sich-Hingeben an einen Tag ohne Pflicht und Ziel.
In den Talkshows unserer Zeit reden Prominente gerne davon, wie sehr sie sich nach «mehr Musse» sehnen. Es gehört fast schon zum guten Ton, den Wunsch nach Faulheit öffentlich zu bekennen – ein bisschen gepflegtes Nichts-Tun als Ausgleich zur Dauerpräsenz auf Bühne und Bildschirm. Hinter den Kulissen aber rackern dieselben Leute mit Coaches, Stylisten, Social-Media-Teams und PR-Agenturen, um dieses Bild zu pflegen.
Ganz anders die Lage bei jenen, die nicht arbeiten – nicht, weil sie sich ein Sabbatical gönnen oder ein Buch schreiben, sondern weil sie arbeitslos sind. Wer keine Lohnarbeit hat, gilt schnell als «faul», als Belastung, als jemand, der sich drückt. Kaum ein anderes Wort erzeugt derart viel Verachtung. Faulheit – das klingt nach Schimmel, nach Verfall, nach moralischer Schlamperei.
Ich erinnere mich noch gut an die Warnung meines Primarlehrers: «Wer faul ist, wird es zu nichts bringen.» Er meinte es gut. Und vielleicht hat er auch recht gehabt – unter den Bedingungen einer Welt, die Leistung über alles stellt. Aber ich frage mich heute: Wohin hat uns diese ewige Betriebsamkeit gebracht?
Wir haben das Recht auf Arbeit zur heiligen Kuh erklärt – dabei war es ursprünglich eine soziale Forderung: Wer arbeiten will, soll auch arbeiten dürfen. Doch längst ist daraus eine Pflicht geworden. Der Mensch ist nur noch etwas wert, wenn er etwas «leistet». Und wer einmal nichts tut, wird schon beim Nichtstun nervös.
Dabei wäre das Recht auf Faulheit – wie es Paul Lafargue schon 1883 formulierte – geradezu revolutionär. Lafargue war übrigens der Schwiegersohn von Karl Marx. In seinem Pamphlet «Das Recht auf Faulheit» (französisch: Le Droit à la Paresse) schrieb er:
«Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder … Es ist dies die Liebe zur Arbeit, die rasende bis zur Erschöpfung der Individuen und Nachkommenschaft gehende Arbeitssucht.»
Er sah in der glorifizierten Arbeit nicht nur eine Quelle des Elends, sondern auch ein Herrschaftsinstrument.
Heute simulieren viele Menschen in Fitnessstudios das, was früher harte körperliche Arbeit war. Damals wurde man für Schweiss bezahlt – heute zahlt man für ihn. Grossvater bekam Lohn, wenn er sich plackte. Wir hingegen legen Monatsabos hin, um bei Kunstlicht auf Fahrrädern zu strampeln, die nicht vom Fleck kommen. Danach brauchen wir Physiotherapie und Massagen – von der Krankenkasse teilweise übernommen.
Und dennoch sind es oft genau diese Momente der Untätigkeit, die uns aufatmen lassen. Wer einmal auf einer Bank sitzt, ohne aufs Handy zu schauen, einfach nur in die Landschaft – oder ins Leben – hineinzuschauen, weiss, was ich meine. Faulheit hat mit Freiheit zu tun. Mit der Freiheit, sich treiben zu lassen. Ohne Produktivität, ohne Zweck. Nur so können Gedanken fliegen.
Der französische Sänger Georges Moustaki, der 2013 verstarb, war ein Freund dieses Gedankens. Auch er sprach vom Recht auf Faulheit. Nicht, weil er ein Nichtsnutz war – im Gegenteil, er arbeitete hart an seiner Musik. Aber er erkannte, dass Arbeit nicht alles ist. Moustaki sagte einmal, wer mehr als zwei Stunden pro Tag arbeite, der tue es selten noch mit Freude. Wer hingegen weniger arbeite, arbeite besser. Denn dann bleibt Raum – für Kreativität, für Begegnungen, für sich selbst.
Und auch die Dichter haben längst erkannt, dass Faulheit ihren Reiz hat. Gotthold Ephraim Lessing dichtete einst:
«Lasst uns faul in allen Sachen,
Nur nicht faul zu Lieb‘ und Wein,
Nur nicht faul zur Faulheit sein.»
Ich mag diesen Vers. Er zeigt: Faulheit ist nicht das Gegenteil von Leben – sie ist eine Spielart davon. Eine, die wir verlernt haben.
Vielleicht brauchen wir heute wieder eine Rehabilitierung der Faulheit. Nicht als Lebensmodell, sondern als Gegenentwurf zur Selbstoptimierung. Als Antwort auf die ständige Frage: «Was hast du heute geleistet?» – Manchmal ist die ehrlichste Antwort: «Nichts – und es war schön.»
Wenn ich auf der sonnigen Terrasse im Liegestuhl liege, Luzi schnurrend in der Nähe, die Gedanken leicht und der Tag ohne Programm, dann bin ich nicht faul – ich bin bei mir. Und vielleicht ist das ja die wichtigste Arbeit überhaupt: bei sich selbst anzukommen.


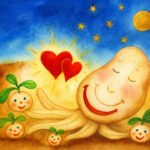




Ich schätze ihre Gedanken und bin sehr angetan von ihrem Blog, vielen Dank!
Lieber Herr Bernhard,
ganz herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung – das freut mich sehr! Es ist schön zu wissen, dass meine Gedanken und Geschichten Anklang finden.
Alles Gute und auf ein Wiederlesen!
Ich bin Fan,
lieber BodeständiX,
von allen, die die Faulheit lieben! 🙂
Ob Georges Moustaki oder Pippi Langstrumpf, die Astrid Lindgren singen liess:
„Faulsein ist wunderschön,
denn die Arbeit hat noch Zeit.
Wenn die Sonne scheint
und die Blumen blühn,
ist die Welt so schön und weit.“
Mit einem herzlichen Gruss in die Woche
Hausfrau Hanna
Liebe Hausfrau Hanna
Wie schön, Dich hier zu lesen – und was für ein herrlicher Vers von Astrid Lindgren!
Pippi Langstrumpf hätte vermutlich auch das Manifest von Paul Lafargue unterschrieben – allerdings in ihrer eigenen Sprache und mit einem Apfel in der Hand, während sie barfuss auf dem Küchentisch balanciert…
Du bringst es auf den Punkt:
Faulsein kann etwas Wunderschönes sein – nicht als Flucht vor dem Leben, sondern als Hinwendung zum Wesentlichen. Sonne. Blumen. Zeit. Und der Mut, einmal nichts zu tun, wenn alle Welt rennt.
Ich schick Dir ein stilles Nicken vom Liegestuhl aus – mit Luzi in Reichweite und dem Gedanken, dass vielleicht sogar die Welt ein kleines bisschen besser wäre, wenn mehr Leute sich ab und zu in die Hängematte legen würden.