Jodeln ist urschweizerisch. Aber was, wenn ausgerechnet die ältesten, wildesten, eigenwilligsten Formen des Jodels systematisch verdrängt wurden? Eine kulturhistorisch-ironische Spurensuche zwischen vokaler Vielfalt, Verbandsdogmen und einer kleinen Revolution mit grossem Nachhall.
Das Wort zum Anfang: Ordnung muss sein
Man stelle sich eine friedliche Jodlerrunde im Emmental um 1900 vor. Ein paar Männer stehen beieinander, dampfender Atem, Melodien wie aus der Landschaft gewachsen. Einer juchzt ein jü-hi, ein anderer ein ho-ia-ri, und mittendrin gurgelt ein fröhliches e-ri-li-ho. Kein Dirigent, keine Noten, keine Regeln. Nur Stimmen, Töne – und viel Herz.
Doch diese Zeiten sollten bald vorbei sein. Am 8. Mai 1910 gründete sich in Bern die Schweizerische Jodlervereinigung (1932 erfolgte die Umbenennung in «Eidgenössischer Jodlerverband»), und mit ihm begann eine neue Ära – eine, in der das freie Jodeln nach und nach einem streng kodifizierten Gesangsideal wich. Was jahrhundertelang als Ausdruck regionaler Eigenart galt, wurde plötzlich unter das wachsame Auge der «Jodlerischen Reinheit» gestellt.
Ein besonders denkwürdiges Dokument dieser Entwicklung ist eine Schulungsunterlage aus der Frühzeit des Verbands, in der mit militärischer Klarheit zu lesen steht:
«Die Parole des E.J.V. aber ist: in unserm herrlichen Fortschritt des schweizerischen Jodelgesanges alles Unschweizerische erbarmungslos auszumerzen.»
Was genau als «unschweizerisch» galt, war schnell definiert: Alles, was klang wie Tirol. Denn dort – auf der anderen Seite des Alpenhauptkamms – jodelte man anders. Mehr I, mehr Ä, mehr virtuos. Das klang nach «Tirolerei» – und die galt den damaligen Verbandsoberen als fremd, überladen, ja: unsittlich volkstümelnd.
«Von unseren Vorfahren haben wir also die Rufe jo-ho, jo-hu und juhui bestimmt übernommen. So vokalisierten unsere Alten – also mit o und u –, und so halten auch wir es.»
Mit dieser Parole begann die systematische Verdrängung des Naturjodels, der bis dahin in fast jeder Talschaft anders klang – und genau deshalb so lebendig war.
Die vokale Säuberung: Das «Reinheitsgebot» im Jodeln
Bevor der Eidgenössische Jodlerverband sich seiner vokalischen Läuterungspflicht annahm, war das Jodeln in der Schweiz ein wilder Garten: kein gepflegter Rosengarten mit klaren Beeten, sondern eher eine Alpwiese im Spätsommer – voller Töne, Silben, Eigenarten. Jede Region, jedes Tal, ja manchmal sogar jedes Dorf hatte seine eigenen Klangfarben.
Da wurde im Appenzell ein I gezogen, das bis ans Ende des Alpsteins hallte, während im Oberwallis eher kehlig gegurgelt wurde. Die Freiburger wiederum liebten es, die Vokale zu stauchen, als wollten sie damit das Echo selbst auf den Punkt bringen. Und ganz ungeniert mischten sich hier und da auch Tiroler Vokalisationen unter die heimischen Laute – etwa das sogenannte «Tiroler-I», jenes helle, oft verspielt eingesetzte I, das in österreichischen Jodelformen besonders prominent ist.
Diese klangliche Vielfalt war keineswegs eine folkloristische Spielerei – sie war Teil gelebter Alltagskultur. Auf der Alp, beim Abtrieb, beim Heuet, bei Festen – man jodelte, um zu rufen, zu rühren. Man jodelte, um das Herz zu lüften. Und niemand wäre damals auf die Idee gekommen, einem Sennen zu erklären, er jodle «falsch», nur weil ein I mehr als ein U vorkam.
Was heute oft verdrängt wird: Das Jodeln mit «Tiroler-Vokalisation» war bis weit ins 20. Jahrhundert auch in der Schweiz verbreitet. Der Begriff «tirolern» wurde im 19. Jahrhundert durchaus synonym für «jodeln» verwendet – nicht abwertend, sondern beschreibend. In alten Liedaufzeichnungen tauchen oft melismatische, verspielte Jodelmotive auf, die eher an die Zillertaler Musik erinnern als an das spätere Basismaterial des EJV.
Dass ausgerechnet diese vokale Vielfalt später unter das Verdikt des «Unschweizerischen» fiel, sagt viel über den Zeitgeist: Die junge Schweiz suchte nach kultureller Selbstvergewisserung – und da passte das vokale Flackern aus dem Osten offenbar nicht ins Raster.
Mit der Gründung des Jodlerverbandes 1910 war der Grundstein für ein strenges Regelwerk gelegt. Der Verband wurde zu einer Institution, die das Jodeln nach einem festen Schema organisierte und bestimmte, was als «echt schweizerisch» zu gelten hatte. Die Regel lautete:
«Die Parole des E.J.V. aber ist: in unserm herrlichen Fortschritt des schweizerischen Jodelgesanges alles Unschweizerische erbarmungslos auszumerzen.»
Erbarmungslos auszumerzen. Sprachlich ein Ausdruck von seltener Härte, der sich wie ein Erlass aus autoritärer Feder liest. Wer da noch mit einem «i» in der Stimme auftauchte, war ein akustischer Querulant. Der Verband kannte kein Pardon.
Besonders ins Visier geriet die sogenannte «Tirolerei». Damit war jede vokale Verspieltheit gemeint, jeder Ansatz eines helleren Jodelstils, wie er im Alpenraum über Landesgrenzen hinweg praktiziert wurde. Die Abgrenzung war nicht nur klanglich, sondern ideologisch.
«Von unseren Vorfahren haben wir also die Rufe jo-ho, jo-hu und juhui bestimmt übernommen. So vokalisierten unsere Alten – also mit o und u –, und so halten auch wir es.»
Was wie eine freundliche Weitergabe von Tradition klingt, ist in Wirklichkeit ein normativer Eingriff in lebendige Kulturpraxis. Niemand hatte «die Alten» befragt, welche Vokale sie bevorzugt hätten. Sie sangen, was ihnen einfiel, oft regional verschieden, oft lustvoll individuell.
Was verloren ging – und was heute fehlt
Vom Ruf der Berge zur Norm auf dem Papier
Mit der vokalischen Säuberung des Jodels verschwand ein ganzer Schatz an klanglicher Vielfalt, regionaler Eigenart und emotionaler Unmittelbarkeit. Der Naturjodel war mehr als eine musikalische Praxis. Er war ein Ausdruck innerer Bewegung, ein Zwiegespräch mit der Landschaft, mit Tieren, mit dem eigenen Herzklopfen.
Ein Hoffnungsschimmer kommt von Musikerinnen wie Nadja Räss. Wenn sie dem Jüüzli in den verschiedenen Regionen nachspürt und dabei entdeckt, wie unterschiedlich die Vokalisation je nach Landschaft und Herkunft ausfällt, dann ist das nicht nur musikethnologische Fleissarbeit. Wenn sie dabei gleichzeitig aufdeckt, dass der Jodlerverband mit seiner starren Reglementierung und Vereinheitlichung genau diese vokale Wildheit zerstört hat, dann ist das eine geradezu revolutionäre Kulturtat.
Vielleicht, so darf man hoffen, wird der Naturjodel nicht museal konserviert, sondern lebendig rekultiviert – als Ausdruck dessen, was der Mensch eben nicht normieren kann: seine Stimme im freien Raum.
Ein Loblied auf das I
Warum auch ein heller Ton Heimat sein darf
Es ist höchste Zeit, dem verbannten Vokal ein Denkmal zu setzen. Dem I, das einst fröhlich durch die Täler schallte, bevor es vom vokalen Tugendgericht des Jodlerverbandes zur persona non grata erklärt wurde. Es war zu hell, zu lebendig, zu tirolerisch – und damit nicht schweizerisch genug.
Doch wer hat eigentlich je entschieden, welcher Ton ein Schweizer ist? Seit wann trägt ein Vokal einen Pass?
Vielleicht war es ein Missverständnis der jungen Schweiz – die in Zeiten nationaler Selbstvergewisserung lieber mit dem Lineal als mit dem Ohr urteilte. Vielleicht war es aber auch einfach der Hang zur Ordnung, der sich bis ins Klanggewebe vortastete. So oder so: Dem I wurde Unrecht getan.
Denn es hat uns nichts getan, das I. Es will nur juchzen. Es will leuchten, wenn der Mensch in Bewegung ist, wenn ihm das Herz übergeht. Das I ist ein Vokal der Lebendigkeit. Und was ist schweizerischer als eine gepflegte Lebendigkeit?
Also: Hoch die Vokale, tief die Stimme, frei der Ruf! Lasst uns jodeln, wie uns der Schnabel gewachsen ist – mal mit O, mal mit U, mal mit einem I, das sich nicht mehr verstecken muss.
Quellen:
- Nadja Räss: Jodeln – Tradition und Innovation
- Jost Marty: Jodeln in der Schweiz
- Schweizerisches Volksliedarchiv
- Schweizerische Nationalphonothek
- Eidgenössischer Jodlerverband: Verbandschronik und Schulungsunterlagen




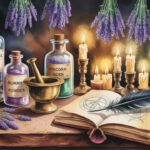


0 Kommentare