Die kalten Wintermonate neigen sich dem Ende zu, und vielerorts wird die Fasnacht vorbereitet. Das Fasnachtsfieber bricht aus, allerorten wird geschunkelt und gelacht, die Rätschen rasseln und die «Guggen» röhren. Spass, Tanz und Unterhaltung sind angesagt. Doch dieser Überschwang des Feierns war nicht immer selbstverständlich.
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Freude an der Bewegung und das ausgelassene Feiern in der Schweiz nicht zu jeder Zeit erwünscht waren. Insbesondere die Reformation brachte tiefgreifende Veränderungen mit sich und verdammte alles Lebendige, Bunte und ursprünglich Gewachsene. Besonders im Visier stand das Tanzen.
Die Bedeutung des Tanzes in der Gesellschaft
Seit Urzeiten ist der Tanz eine der elementarsten Ausdrucksformen des Menschen. Er erfüllt vielfältige Funktionen, sei es als Ausdruck der Lebensfreude, als kultisch-religiöses Ritual oder als Form der sozialen Interaktion. Überall auf der Welt entwickelten sich eigene Tanztraditionen, die das kulturelle Leben prägten. In der heutigen Schweiz existierten bis ins 16. Jahrhundert nebeneinander:
- Rituelle Tänze, die im Brauchtum fest verankert waren und an bestimmte Orte und Termine gebunden blieben.
- Gesellige Tänze, die in Dörfern und Städten als Teil der Unterhaltung und des Gemeinschaftslebens gepflegt wurden.
Tanzen war damit fester Bestandteil des Alltagslebens. Doch mit der Reformation kam eine Wende.
Die Reformation und das Tanzverbot
In den 1530er-Jahren griffen in den reformierten Gebieten der Schweiz sogenannte Sittenmandate immer stärker in das Alltagsleben ein. Diese Verordnungen wurden erlassen, um moralisches Verhalten zu regulieren und sündhafte Vergnügungen zu unterbinden. Dabei rückte der Tanz als vermeintlich «heidnischer» Akt ins Zentrum der Kritik. Besonders die Anhänger von Zwingli und Calvin führten eine harte Linie gegen «lasterhafte Freuden».
Das Tanzverbot wurde mit Strafen und Bussen durchgesetzt. In Zürich, Bern oder Basel wurden Tanzveranstaltungen massiv eingeschränkt oder gänzlich untersagt. Nur an wenigen Tagen im Jahr war das Tanzen offiziell erlaubt, beispielsweise:
- Neujahrstag
- Fasnacht (später auch diese umstritten und vielerorts verboten)
- Markttage
- Kirchweihfeste
Der Kampf gegen das Tanzvergnügen
Der reformierte Stadtstaat Bern, bekannt für seine besonders strenge Sittenpolitik, entwickelte einen ausgeprägten Kontrollapparat, um Tanzlustige zu überführen. Besonders drastisch war ein Vorfall im Jahr 1675, als Pfarrer Spengler in Dürrenroth Anzeige erstattete, weil «in dem Nüwhaus in der Müslen sei gekiltet oder gar getanzet worden». Der Übeltäter? Ein junger «Schülerknab», der als Geiger für die Musik sorgte. Zur Strafe wurde sein Instrument durch den Sigristen öffentlich zerschlagen. Diese Art von rigider Strenge zeigt, wie ernst es den reformierten Obrigkeiten mit der Durchsetzung ihrer Moralvorstellungen war.
Widerstand gegen die Tanzverbote
Doch das Volk liess sich nicht so leicht das Vergnügen nehmen. Trotz aller Restriktionen wurden Tanzveranstaltungen weiterhin durchgeführt, oft heimlich und im Verborgenen. Während in den katholischen Gebieten das Tanzen weiterhin geduldet oder sogar gefördert wurde, hielt sich in den reformierten Kantonen die Skepsis gegenüber weltlichen Freuden noch lange.
Ab dem 19. Jahrhundert kam es mit der zunehmenden Liberalisierung zu einer Renaissance des Tanzes. Neue Modetänze fanden Einzug in die Schweiz, darunter:
- Walzer, Schottisch, Mazurka und Polka im 19. Jahrhundert.
- Tango und andere südamerikanische Tänze nach dem Ersten Weltkrieg.
- Swing, Rock ’n‘ Roll, Madison und Twist nach dem Zweiten Weltkrieg.
- Später folgten Disco, Techno und moderne Clubtänze, die den traditionellen Paartanz zunehmend ablösten.
Die Spätfolgen der Sittenmandate
Obwohl die strengen Tanzverbote heute keine direkte Wirkung mehr entfalten, könnten ihre Spuren noch immer in den gesellschaftlichen Strukturen nachhallen. In der Schweiz, die historisch sowohl von protestantischen als auch von katholischen Traditionen geprägt ist, zeigt sich in vielen Regionen eine gewisse Zurückhaltung im gesellschaftlichen Leben. Besonders in reformierten Kantonen wird oft eine nüchternere und disziplinierte Haltung gepflegt, während in katholisch geprägten Gebieten Feste und Traditionen mitunter ausgelassener gefeiert werden.
Nachwirkungen bis heute
Die Reformation veränderte die Schweiz tiefgreifend. Sie brachte eine nüchterne Ethik mit sich, die nicht nur die Religion, sondern auch den Alltag der Menschen nachhaltig prägte. Das Verbot des Tanzes war nur ein Ausdruck dieses Wandels, aber es zeigt eindrücklich, wie stark das Bestreben nach Ordnung und Sittenstrenge das kulturelle Leben beeinflusste. Auch wenn sich die Tanzfreude längst wieder entfaltet hat, bleibt die Frage: Wirken die alten Sittenmandate immer noch in den Köpfen nach? Ein Blick auf die Fasnacht, das grosse, alljährliche Ventil für überschüssige Lebensfreude, könnte darauf eine Antwort geben.


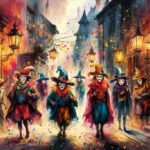




0 Kommentare