Im September ist es in Utzenstorf BE wieder soweit: die Kartoffelernte beginnt. Wer mit offenen Augen durchs Dorf fährt, sieht auf den Feldern die Maschinen arbeiten, hört ihr Rattern und Klingen, und dazwischen viele Hände, die flink nach den Knollen greifen, um Steine und die «schlechten» Exemplare auszusortieren.
Es ist ein eigenartiger Klangteppich: das dumpfe Poltern der Kartoffeln auf das Metall der Förderbänder, das Brummen des Motors, das leise Reden der Helferinnen und Helfer, manchmal unterbrochen vom Ruf des Bauern. Und dazu der Geruch von feuchter Erde, frisch aufgebrochen, durchzogen von dem unverkennbaren Duft der Kartoffeln.
Auch ich stehe seit bald zwanzig Jahren regelmässig auf der Kartoffelerntemaschine. «Graber» nennen wir diese imposante Maschine. Manchmal ist es eine Plackerei – Staub in den Augen, Rückenschmerzen, das monotone Rattern im Ohr. Doch meistens ist es ein Genuss. Die Septembersonne wärmt den Rücken, der Blick schweift über die Felder, und die Hände werden schwarz von Erde, während die Knollen unter den Fingern durchlaufen. Ein Stück Arbeit, das zugleich erdet.
Dieses Jahr scheint die Ernte reichlich auszufallen. Die Kartoffeln purzeln in grossen Mengen aus dem Boden, jede anders geformt, manche makellos glatt, andere runzlig und krumm. In den Händen hält man nicht nur Nahrung, sondern ein Stück Lebenszeit, ein Stück Natur, das sich aus Erde, Regen und Sonne geformt hat.
Die Kartoffel – ein Geschenk der Geschichte
Dabei vergisst man leicht, dass die Kartoffel selbst eine lange Geschichte hinter sich hat. Sie stammt ursprünglich aus Südamerika und fand im 16. Jahrhundert über Spanien ihren Weg nach Europa. Zuerst belächelt, dann mit Misstrauen betrachtet, wurde sie erst im 18. Jahrhundert zur wirklichen Lebensretterin.
Auch in der Schweiz dauerte es, bis man Vertrauen fasste. In vielen Gegenden hielt man die Knolle für Viehfutter, manche glaubten sogar, sie sei ungesund. Erst als Hungersnöte das Land heimsuchten, begann man, ihre Kraft zu schätzen. Seither ist sie aus unserer Ernährung nicht mehr wegzudenken – ob als Rösti, Gschwellti, Kartoffelsuppe oder Gratin.
Die Kartoffel war nie bloss eine Pflanze. Sie war Überlebenshilfe. Sie war Hoffnung in harten Zeiten. Und sie ist bis heute Symbol für das Einfache, Bodenständige geblieben.
Auch in der Schweiz dauerte es, bis man Vertrauen fasste. In vielen Gegenden hielt man die Knolle für Viehfutter, manche glaubten sogar, sie sei ungesund. Erst als Hungersnöte das Land heimsuchten, begann man, ihre Kraft zu schätzen. Seither ist sie aus unserer Ernährung nicht mehr wegzudenken – ob als Rösti, Gschwellti, Kartoffelsuppe oder Gratin.
Die Kartoffel war nie bloss eine Pflanze. Sie war Überlebenshilfe. Sie war Hoffnung in harten Zeiten. Und sie ist bis heute Symbol für das Einfache, Bodenständige geblieben.
Von der Gemeinschaft zur Maschine
Früher war die Ernte ein Dorferlebnis. Familien, Nachbarn, Kinder – alle halfen mit. Es war nicht nur Arbeit, sondern auch Begegnung. Ein Fest der Hände, ein Ritual der Dankbarkeit. Danach sassen alle beisammen, es gab Suppe oder Eintopf, und man spürte, dass die Arbeit getragen war von Gemeinschaft.
Heute ist vieles anders. Maschinen übernehmen den grössten Teil der Arbeit, die Helfer sind nur noch wenige. Für die meisten Menschen in der Stadt ist die Kartoffelernte ein unsichtbarer Vorgang. Sie nehmen die Kartoffeln aus dem Regal des Grossverteilers – sauber geputzt, in Plastik verpackt, ohne einen Gedanken daran, wie viel Erde und Mühe dahintersteckt.
Damit ist etwas verloren gegangen: das Bewusstsein für den Zyklus des Lebens. Aussaat, Wachsen, Reifen, Ernte – einst selbstverständlich, heute fast vergessen.
Die verlorene Sichlete
In manchen ländlichen Gegenden wird noch eine «Sichlete» gefeiert – ein Erntedankfest. Doch vielen erscheint das heute als alter Brauch, als ländliche Folklore ohne Bedeutung. Wer sagt heute noch wirklich «Danke» an die Natur?
Dabei steckt in diesem Ritual eine tiefe Wahrheit. Dankbarkeit bedeutet, den Zusammenhang zu sehen: dass Nahrung nicht einfach im Regal entsteht, sondern aus Erde und Sonne, aus Regen und Handarbeit.
Eine Kartoffel kann viele neue Kartoffeln schenken. Ein einziger Keim trägt die Fülle in sich. Mutter Natur ist verschwenderisch grosszügig. Wer hinschaut, merkt: Wir leben nicht in einer Welt der Knappheit, wie uns oft erzählt wird. Wir leben in einer Welt der Fülle – wenn wir sie zu nutzen verstehen.
Fülle und Leere
Die Kartoffel lehrt uns einen einfachen Gedanken: Alles hat seine Zeit. Die Natur gibt im Herbst, und sie ruht im Winter. Auf das Einbringen folgt die Stille. Auf die Fülle die Leere.
Und doch ist diese Leere keine Bedrohung, sondern Voraussetzung. Nur wer ruht, kann wieder wachsen. Nur wer den Winter aushält, hat im Frühling Kraft für neues Leben.
Unser modernes System aber kennt keine Ruhe. Wir säen im Winter, wir ernten im Winter, wir konsumieren ohne Pause. Die Regale sind immer gefüllt, die Maschinen laufen ununterbrochen. Die Natur hat Zyklen – der Mensch hat nur das Immer-Weiter.
So kommt es, dass wir die Zeichen der Natur nicht mehr deuten können. Wir haben das Wissen um den Sinn des Zyklus verloren.
Ein Symbol für unser Leben
Die Kartoffel ist ein Gleichnis. Sie zeigt, dass Wert nicht im Äusseren liegt. Manche Knollen sind krumm, andere makellos – doch alle nähren. Manche wirken unscheinbar, und doch steckt in ihnen die Kraft, ganze Familien satt zu machen.
So ist es auch mit unserem Leben. Wert liegt nicht im Glanz, sondern in der Fruchtbarkeit, in dem, was wir weitergeben.
Vielleicht sollten wir uns an der Kartoffel ein Beispiel nehmen: Demütig in der Erde wachsen, mit Geduld reifen, und zur rechten Zeit Fülle schenken.
Am Ende bleibt die Erde
Es gibt einen Satz von Nietzsche, der mich immer wieder begleitet:
«Unter einem dünnen Apfelhäutchen brodelt das Chaos.»
Vielleicht wollte er sagen: Unter der Oberfläche des Alltäglichen liegt immer das Unberechenbare. Auch in der Natur, auch im Leben. Doch in dieser Unberechenbarkeit liegt die eigentliche Kraft.
Die Kartoffel erinnert uns daran, dass wir Teil dieser Kraft sind. Sie verbindet uns mit Erde und Zyklus, mit Fülle und Leere, mit Dankbarkeit und Vergänglichkeit.
Am Ende ist sie mehr als Nahrung. Sie ist ein Symbol dafür, dass alles Wertvolle im Unsichtbaren beginnt – in der Erde, im Dunkel, im Stillen.
Bild: Kartoffelmama, Kunigunde Gautschin, Oberdorf BL




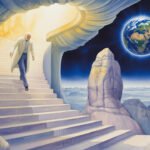


0 Kommentare