Wenn die Karten auf dem Tisch liegen, herrscht für einen Moment eine eigene Ordnung. Da zählt nicht, wer man ist, sondern welche Karte man in der Hand hat.
Und doch erzählen die Karten selbst Geschichten – von Herkunft und Wandel, von gesellschaftlichem Aufstieg und dem Beharrungsvermögen der Alltagskultur. Besonders die sogenannten «französischen Jasskarten», mit denen heute fast flächendeckend in der Deutschschweiz gejasst wird, sind ein stiller Spiegel dieser kulturellen Bewegungen. Dabei sind sie, so erstaunlich es klingen mag, weder alt noch ursprünglich schweizerisch – sondern ein Produkt aus Leipzig.
Wer hätte gedacht, dass der König mit dem Schwert, die Dame mit der Blume und der Bube mit der Hellebarde einst Modefiguren der Pariser Haute Couture waren?
Wenn Alltägliches fremd wird
Im Alltag sind sie unsichtbar. Jasskarten sind so selbstverständlich, dass kaum jemand auf die Idee kommt, ihre Herkunft zu hinterfragen. Sie liegen auf dem Beizentisch neben dem Stammtischbier, in der Schublade beim Radio, im Rucksack der Soldaten – und gehören zum kulturellen Inventar vieler Familien. Kaum jemand weiss, dass die heute als typisch schweizerisch empfundenen «französischen» Jasskarten nicht etwa aus der Westschweiz stammen, sondern als Luxusprodukt aus Sachsen – genauer gesagt: aus dem Königreich Sachsen, Mitte des 19. Jahrhunderts.
Sie entstanden aus einem Spielkartenbild, das seinerseits auf das portrait de Paris zurückgeht – ein Bildtypus, der im 17. und 18. Jahrhundert in Frankreich beliebt war. Elegant, modisch, fein gezeichnet. Die Buben trugen Hellebarden, die Damen Blumen, die Könige Zepter oder Schwert. Es war ein höfisches Bild – aristokratisch und modern zugleich.
Wie dieses Bild aus der Welt der Pariser Salons und sächsischer Druckereien seinen Weg in die Bauernstuben und Beizen der Schweiz fand – das ist die stille Erfolgsgeschichte des sogenannten «französischen Jasses», auch bekannt unter der nüchternen Bezeichnung XP-11.
Drei Farbenwelten und viele Gesichter
Wer die Schweiz kennt, weiss: Einheit war nie ihre Stärke – Vielfalt hingegen schon. Das gilt auch für die Spielkarten. Drei Farbsysteme haben sich bis heute gehalten:
– das «deutsche» System mit Eicheln, Schilten, Rosen und Schellen (und den Figuren Under, Ober, König)
– das französische System mit Herz, Karo, Pik und Treff (mit Bube, Dame und König)
– und das italienische, vor allem im bündnerischen Tarock mit Kelchen, Münzen, Schwertern und Stäben.
Diese Systeme sind mehr als nur Varianten – sie markieren kulturelle Grenzen. Die deutschsprachige Schweiz spielt traditionell anders als die französischsprachige – und im Süden lebt mit dem Tarock eine ganz eigene Tradition fort. Was heute wie eine gewachsene Ordnung erscheint, war einst ein buntes Durcheinander verschiedenster Bildtypen.
Und doch setzte sich eines durch: XP-11 – das heute verbreitetste französischfarbige Kartenbild der Schweiz.
XP-11: Von Paris nach Leipzig, von dort in die Schweiz
Die Bezeichnung XP-11 stammt von Spielkartenforschern, die diesem Typus eine systematische Nummer gaben. Das Kürzel steht für «Expatriate Paris», also für jene Bildformen, die sich vom Pariser Ursprungsbild ableiten, aber ausserhalb Frankreichs weiterentwickelt wurden. XP-11 wurde um 1837 erstmals in Leipzig vollständig als Typus gezeichnet und galt damals als fein gedrucktes Luxusblatt. Gedruckt wurde es in Stahlstichtechnik, koloriert mit Schablonen – für das einfache Volk war es unerschwinglich.
Doch wie das mit kulturellen Dingen so ist: Was bei den feinen Herrschaften beginnt, wandert irgendwann hinunter zum Volk. Um 1860 wurde XP-11 auch im Holzschnitt produziert – einfacher, günstiger, robuster. Und schon bald fand es seinen Weg in die Schweiz. Zuerst in jene Regionen, wo französische Farben bereits bekannt waren – also im Mittelland, im Aargau, im Thurgau. Von da an begann ein stiller Siegeszug.
Von der Elite in die Stube: der Wandel zur Volkskarte
Zuerst war XP-11 keine Jasskarte, sondern eine Spielkarte für moderne Spiele wie Whist oder Piquet. Es waren gebildete, meist städtische Kreise, die diese Spiele bevorzugten – eine neue Bourgeoisie, die in den bürgerlichen Salons der Gründerzeit zu Hause war. Die alten, «einfigurigen» Bilder passten nicht mehr zum neuen Selbstverständnis. Man wollte doppelköpfige Karten – modern, praktisch, ordentlich.
Und auch die Mode veränderte sich. Die Damen auf den Karten trugen nun bravere Kleider, angepasster an die bürgerliche Moral. Was in den sächsischen Luxusblättern noch mit tiefem Ausschnitt daherkommt, wird im Schweizer Holzschnitt züchtig übermalt. Kulturgeschichte zum Anfassen – in der Darstellung einer Spielkarten-Dame.
Der industrielle Aufstieg – und Müllers Monopol
Der Name Müller ist untrennbar mit der Verbreitung von XP-11 verbunden. Johannes Müller I. übernahm 1838 die Spielkartenfabrik in Diessenhofen, später in Schaffhausen. Er war es, der XP-11 in die Schweiz brachte – und Johannes Müller II., sein Nachfolger, machte daraus das Standardbild. Besonders geschickt: Müller bot XP-11 nicht als neues Bild an, sondern als doppelköpfige Variante eines bereits bekannten einfigurigen Typs. Der Übergang war fliessend – kaum jemand merkte, dass man sich auf neue Bilder einliess.
Müller war kein Spieler, aber ein schlauer Geschäftsmann. Er baute die industrielle Produktion systematisch aus, rationalisierte, vereinheitlichte, schloss Konkurrenten aus. Bis um 1890 hatte er faktisch das Spielkartenmonopol in der Deutschschweiz. Wer also neue Karten kaufte, bekam mit grosser Wahrscheinlichkeit ein XP-11-Blatt aus Schaffhausen.
Und dann kam der Jass
Die entscheidende Wendung aber brachte nicht ein Fabrikant, sondern ein Spiel: der Jass. In den 1790er-Jahren von Söldnern aus holländischem Dienst mitgebracht, verbreitete sich das Spiel rasch im Osten der Schweiz. Um 1850 verdrängte es fast alle anderen Spiele – und wurde zum Volkssport. Jassen war nicht einfach Kartenspielen – es war Stammtisch, Männerbund, Unterhaltung, Herausforderung, Tradition.
Und es brauchte ein handliches, robustes Kartenset mit 36 Karten – genau das, was XP-11 bieten konnte. Die Verbindung war wie geschaffen füreinander. Mit dem Jass verbreitete sich auch das Kartenbild – und bald wurde XP-11 zum «Jassbild», auch wenn es ursprünglich nichts mit dem Spiel zu tun hatte.
Der Westen zögerte – doch der Krieg schuf Einheit
Während in der Ostschweiz längst mit XP-11 gejasst wurde, hielt sich im Westen der Schweiz hartnäckig das Genfer oder Neuenburger Bild – jeweils französischfarbig, aber in ganz anderer Darstellung. Noch in den 1920er-Jahren bot Müller beide Varianten an – um auch den Westschweizer Markt zu bedienen. Erst der Aktivdienst im Ersten Weltkrieg brachte Bewegung: In den Kasernen lernten Romands den Jass kennen – samt dem dazugehörigen Kartenbild.
So wurde XP-11 durch den Krieg zum nationalen Einheitsbild. Spätestens ab 1950 war es das französische Kartenbild der Schweiz – wohlgemerkt: nördlich der Alpen. Im Tessin, wo man Tarock spielt, dominiert bis heute das lombardische Bild mit Re, Regina und Fante.
Warum das Bild blieb – und was es mit uns macht
Man könnte meinen, XP-11 habe sich durchgesetzt, weil es ästhetisch besonders gelungen war. Das Gegenteil ist der Fall. Selbst Walter Haas, der das Kartenbild wie kein Zweiter erforscht hat, spricht von seiner «ästhetischen Mediokrität». Die Figuren wirken steif, bieder, unspektakulär. Kein Vergleich mit den feinen Linien des Hamburger Vorbilds oder der verspielten Eleganz alter Lyoner Karten.
Und doch blieb das Bild – weil es einmal da war. Weil man sich daran gewöhnt hatte. Weil der Mensch, einmal vertraut mit einem Muster, selten wieder davon ablässt. So wurde XP-11 zum Symbol der schweizerischen Jasskultur – und jeder Versuch, es zu modernisieren, scheiterte.
Im Jahr 2000 versuchte die Firma Müller, mit «Jass Plus» ein neues Kartenbild einzuführen. Das Ergebnis: ein Flop. Statt der erhofften Million verkauften sie gerade einmal 300’000 Sets – und das Projekt wurde eingestellt. Die Spieler wollten ihre alten Damen, Buben und Könige behalten.
Zwischen Alltag und Archiv – die stille Kulturgeschichte
Was lehrt uns die Geschichte der Jasskarten? Sie zeigt, wie tief kulturelle Muster im Alltag verankert sind. Sie entstehen nicht durch Erlass, sondern durch Gewöhnung. Sie sind weder die ältesten noch die schönsten – aber sie sind die vertrautesten. XP-11 ist ein Beispiel für das, was die Kulturwissenschaft als «gesunkenes Kulturgut» bezeichnet: Was einst elitär war, wird zum Alltagsgegenstand – und gerade dadurch identitätsstiftend.
Die Geschichte des «französischen Jasses» ist eine Geschichte von Anpassung und Beharrung, von Markt und Macht, von Mode und Moral. Und sie erinnert uns daran, dass selbst die unscheinbarsten Gegenstände – ein Blatt Jasskarten – ein ganzes Stück Volkskultur in sich tragen.
Quellen:
- Haas, Walter:
Die «französischen Jasskarten»: Über den Wandel von Objekten der Alltagskultur.
In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde (SAVk), Band 109 (2013) - Geiger, Paul / Weiss, Richard / Escher, Walter / Liebl, Elsbeth:
Atlas der schweizerischen Volkskunde – Atlas de folklore suisse.
Basel 1951–1988, Karten 141a–e und Kommentarband I/2 (Kapitel «Spielkarten»). - Ruh, Max:
Schaffhauser Spielkarten.
Zürich: Verlag der Schweizerischen Pioniere der Wirtschaft und Technik, 2005. - Mann, Sylvia:
Alle Karten auf den Tisch – All Cards on the Table.
Leinfelden-Echterdingen / Marburg 1990. Zwei Bände. - Hammer, Peter / Eisenmann, Orlando / Ruh, Max:
Vom Zweier-Sidi zum Dräck-Jass.
Chur 1988.



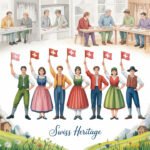



Ab September werden in der Schweiz Amerikanische Karten eingeführt, auf Wunsch der SVP.
Sehen uns am Wochenende. Grüsse aus Europa.