Wie Sprache politisch gesteuert wurde – und was wir aus der Geschichte für heutige Debatten über Sprachwandel und Gendersprache lernen können.
Sprache ist nicht nur Mittel der Verständigung – sie ist ein Spiegel gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Wer die Sprache beeinflusst, gestaltet Wahrnehmung, steuert Denkmuster und kann damit auch Politik machen. Das war im totalitären NS-Staat brutale Realität. Und auch in heutigen demokratischen Gesellschaften entzünden sich an Fragen der Sprache immer wieder kulturelle Kämpfe – etwa beim Gendern, bei der «politischen Korrektheit» oder im Umgang mit «verbotenen Worten».
Doch lässt sich das eine mit dem anderen überhaupt vergleichen?
NS-Sprachpolitik: Einheit durch Gleichschaltung
Die Nationalsozialisten betrieben ab 1933 eine systematische Sprachlenkung, die untrennbar mit ihrem totalitären Machtanspruch verbunden war. Das erklärte Ziel war die «restlose Erfassung» der Bevölkerung durch eine einheitliche, ideologisch aufgeladene Sprache. Joseph Goebbels brachte es auf den Punkt: «Das Volk soll anfangen, einheitlich zu denken, einheitlich zu reagieren.»
In diesem Sinne wurde die Presse gleichgeschaltet, abweichende Meinungen verboten und die Sprache selbst durch Wörterbücher, Lexika und Presseanweisungen genormt. Begriffe wie Volksgenosse, Rassenschande oder Volksschädling prägten die öffentliche Kommunikation. Selbst bestehende Nachschlagewerke wie der Duden oder das Meyers Lexikon wurden durch parteiamtliche Prüfkommissionen redaktionell «korrigiert».
Diese Sprachpolitik war Teil eines umfassenden Machtapparats – gestützt durch Zensur, Überwachung und Gewalt.
Sprache heute: Wandel durch Werte
Auch in unserer Zeit ist Sprache nicht statisch. Sie verändert sich – und mit ihr die Werte, die sie transportiert. Begriffe wie Fräulein, Neger oder Zigeuner sind heute – teils zu Recht – aus dem öffentlichen Sprachgebrauch verschwunden oder hoch umstritten. Die Forderung nach inklusiver, diskriminierungssensibler Sprache, etwa durch das Gendern, ist Ausdruck gesellschaftlicher Auseinandersetzungen um Gleichberechtigung und Repräsentation.
Hier zeigt sich: Auch demokratische Gesellschaften lenken Sprache – allerdings nicht durch staatliche Gewalt, sondern durch Debatte, Aushandlung, Normbildungsprozesse und sozialen Wandel. Genderstern, Doppelformen oder neue Begriffe wie cis, nicht-binär oder Menschen mit Migrationsgeschichte entstehen nicht im Innenministerium, sondern in zivilgesellschaftlichen, oft akademischen Kontexten.
Wo beginnt die Gefahr?
Auch ohne Diktatur kann Sprachpolitik problematisch werden – etwa dann, wenn moralischer Konformitätsdruck entsteht, der Widerspruch tabuisiert. Wer nicht gendert, nicht das aktuelle Vokabular trifft oder sich nicht sprachlich korrekt ausdrückt, riskiert in bestimmten Milieus sozialen Ausschluss. Hier wird Sprache nicht mehr nur als Ausdruck, sondern als Gesinnungsprüfung verstanden.
Dabei ist aus soziolinguistischer Sicht klar: Sprachgemeinschaften entwickeln ständig neue Normen, Regeln und Standards. Das ist nicht neu, sondern ein normaler Prozess – Sprache war nie statisch. Ob Höflichkeitsformen, Anredekonventionen oder Begriffe des Respekts: Gesellschaften handeln aus, wie gesprochen wird. Problematisch wird es jedoch dann, wenn diese Aushandlung aufhört, wenn Alternativen nicht mehr zugelassen oder vollständig delegitimiert werden – sei es durch Spott, Ausgrenzung oder moralische Abwertung.
Das erinnert – in seiner Logik, nicht in seiner Konsequenz – an vergangene Sprachregime: Wenn das falsche Wort genügt, um jemanden öffentlich zu diskreditieren, wird Sprache erneut zum Mittel der Macht.
Ein historisch informierter Umgang mit Sprache bedeutet daher zweierlei: Erstens, sich der politischen Dimension von Sprache bewusst zu sein. Und zweitens, zwischen autoritärer Zwangslenkung und demokratischem Sprachwandel klar zu unterscheiden.
Unterschiede ernst nehmen
Heute existiert kein staatlich zentralisierter Zensurapparat mehr, wie ihn das NS-Regime betrieb – mit Presseanweisungen, Schreibverboten und ideologisch gesteuerten Wörterbüchern. Auch ist es kein Straftatbestand, sich sprachlich gegen den Zeitgeist zu stellen. Doch wer sich öffentlich gegen dominierende Sprachmoden wie das Gendern ausspricht oder politisch nicht konforme Begriffe verwendet, erlebt mitunter erheblichen gesellschaftlichen Druck: Diffamierungen, Karrierehindernisse, digitale Pranger.
Zwar wird das Meinungsmonopol nicht mehr per Gesetz durchgesetzt – doch informelle Mechanismen der Gleichrichtung wirken dennoch. Der Kommunikationswissenschaftler Uwe Krüger spricht in diesem Zusammenhang von einer «mentalen Konvergenz» in vielen Redaktionen: Journalisten würden sich in politischen Grundüberzeugungen stark ähneln und orientierten sich zunehmend an einem normativen «Wir-Gefühl» der Hauptstadtelite (Krüger, 2016). Auch der Medienforscher Michael Meyen diagnostiziert eine Tendenz zur «kognitiven Homogenität» in der deutschen Medienlandschaft, begünstigt durch politische Nähe, ökonomischen Druck und die Angst vor öffentlichem Ausschluss (Meyen, 2021).
Die Vielfalt an Meinungen bleibt formal möglich – doch in der gelebten Praxis entsteht nicht selten ein Konformitätsklima, das an kritischen Debatten nicht reicher, sondern ärmer macht.
Was wir lernen können
Der Blick auf das NS-Sprachregime zeigt in schockierender Deutlichkeit, wozu Sprache fähig ist – wenn sie unter totale Kontrolle gerät. Die heutige Debatte um Sprache bewegt sich in einem anderen Rahmen. Doch auch hier geht es letztlich um Macht über Worte – und damit über Wirklichkeit.
Es wäre gefährlich, beides gleichzusetzen. Aber es wäre ebenso naiv, die politischen Mechanismen von Sprachveränderung zu ignorieren. Sprache bleibt ein Kampfplatz – auch in der Demokratie. Und vielleicht ist genau das ihre Stärke.
Quellenverzeichnis:
- Heinz Sarkowski: Das Bibliographische Institut. Geschichte eines deutschen Verlags, Frankfurt am Main, 1976.
- Victor Klemperer: LTI – Notizbuch eines Philologen, Berlin, diverse Ausgaben.
- W. Dieckmann: Sprache in diktatorischen Systemen, in: Sprache und Politik, hrsg. von Ruth Wodak, Wien 2000.
- Dudenredaktion: Wie sich die Sprache verändert – Geschichte des Dudens, Mannheim, 2020.
- Michael Wildt: Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung – Gewalt im Nationalsozialismus, Hamburg, 2007.
- Ute Frevert: Die Politik der Demütigung – Schauplätze von Macht und Ohnmacht, München, 2017.


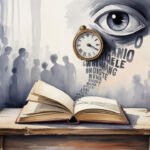




0 Kommentare