Jetzt ist wieder die Zeit, in der die hellen, duftenden Dolden des Holunders die Wegränder, Waldränder und Gärten zieren.
Kaum ein Strauch verströmt solch einen intensiven, beinahe betörenden Duft wie der Holunder in voller Blüte. Zwischen Mai und Juni, je nach Lage, entfaltet er sein weisses Blütenmeer – ein stiller Vorbote des Sommers. In der Volkskultur ist diese Zeit eng mit der Schwelle zur Johannisnacht verbunden, jener magischen Nacht um den 24. Juni, in der sich – so der Glaube – die Welten berühren.
Es ist die Zeit der Sommersonnenwende, der hellsten Tage des Jahres. Eine Schwellenzeit. Und genau da beginnt auch der Holunder seine Wandlung: Von der Blüte zur Frucht. Wie gemacht also, um sich seiner besonderen Bedeutung zu widmen.
Frau Holles heiliger Strauch
In vielen Regionen galt der Holunderbaum als heilig. Er stand nicht irgendwo – sondern mit Bedacht: oft in der Nähe des Hauses oder beim Stall, manchmal auch an Kreuzungen oder nahe bei Quellen. Die Menschen glaubten, dass in ihm eine schützende, weibliche Wesenheit wohnte – eine Art Hausgeist oder göttliche Hüterin. In vielen Gegenden wurde sie mit Frau Holle gleichgesetzt.
Frau Holle ist weit mehr als nur eine Märchenfigur. In ihrem ursprünglich mythischen Kern ist sie eine uralte Göttin – Hüterin von Fruchtbarkeit, Geburt und Tod, von Winter und Wiederkehr, von Spinnkunst und Seelenreise. Sie wacht über das Gleichgewicht der Dinge. Und ihr Baum ist – so sagt man – der Holunder.
Wer einen Holunder fällen wollte, musste früher zuerst um Erlaubnis bitten. So sprach man:
«Frau Holle, Frau Holle, gib mir von deinem Holze, ich will dir’s wieder gut machen mit Milch und Brot.»
Solche Sprüche waren keine leeren Rituale, sondern Ausdruck einer tiefen Verbindung mit der beseelten Natur.
Von Holler, Holder und Holunder – ein Baum mit vielen Namen
Der Holunder hat viele Namen. In Süddeutschland und Österreich nennt man ihn Holler, im Rheinland ist er als Holder bekannt, in Norddeutschland als Eller oder Ellhorn. Auch im Englischen lebt er als elder weiter – sprachlich verwandt mit dem althochdeutschen holuntar.
Und in der Schweiz? Auch hier zeigt sich eine reiche mundartliche Vielfalt. Im Berner Oberland etwa ist vom Huldrich oder Hulder die Rede, im Appenzellischen sagt man Holderbaum oder einfach Holder, im Baselbiet und im Mittelland ist die heute gebräuchlichste Form schlicht Holunder – wobei auch die alte Form Holler in Sprüchen und Kinderreimen weiterlebt. In der Innerschweiz taucht gelegentlich noch die Bezeichnung Häggeli auf – wobei das auch für andere Sträucher wie Traubenkirsche stehen kann.
So unterschiedlich die Namen auch sind, sie alle deuten auf eine besondere Nähe zum Menschen hin – auf einen Baum, der nicht nur Heilmittel spendet, sondern auch Wohnsitz einer besonderen Wesenheit war: der Frau Holle, Hulda oder Holda, die der Sprache nach vielleicht sogar im «Holderbaum» weiterlebt.
Die Nachsilbe «-der», wie sie in Holunder, Wacholder oder Flieder erscheint, findet sich auch in alten Baumbezeichnungen wieder – etwa in Rüster (Ulme) oder dem Ortsnamen Affoltern (zu Apfelbaum). Sprachlich lässt sich nicht eindeutig klären, ob der Baum nach der Göttin benannt ist oder umgekehrt. Mythologisch gesehen aber gehört er ihr.
Ein Schwellenbaum zur anderen Welt
Der Holunder galt im Volksglauben als Schwellenbaum – ein Übergang in andere Wirklichkeiten. Wer sich unter seinen Ästen niederlässt, spürt vielleicht etwas von der Tiefe, die in diesem Strauch wohnt. Alte Geschichten berichten, dass man unter dem Holunder leichter träumt, leichter Visionen empfängt – oder gar Geister sieht.
Moderne spirituelle Deutungen greifen dieses Bild auf: Wer sich unter den Holunder setzt, still wird, sich öffnet, dem kann – in Meditation oder in bewusstseinserweiterter Wahrnehmung – eine Reise ins sogenannte Holle-Reich geschenkt werden. Dort begegnet man, so wird erzählt, den Wesen der Tiefe: Moosmännlein, Elfen, knorrigen Zwergen, uralten Naturgeistern. Frau Holle, so glauben manche, sei ihre Königin. Sie regiert nicht in einem Himmelspalast, sondern im Dunkel der Erde, im Innersten der Wurzeln, in der Anderswelt, die jenseits des Sichtbaren liegt.
Das vergessene Reich
Die meisten Menschen in unseren Breiten besuchen dieses Reich nicht mehr. Die Erinnerung daran ist verblasst – untergegangen in Jahrhunderten der Entzauberung. Erst kamen die Inquisition und die Angst vor dem «Aberglauben», dann die Aufklärung, die alles Geistige ins Reich des Subjektiven verbannte. Ein Schatz an altem Wissen ging dabei verloren, ebenso wie der Zugang zu den beseelten Landschaften, die unsere Ahnen noch selbstverständlich bewohnten.
Doch hin und wieder findet jemand den Weg zurück. Wer mit dem Herzen schaut, mit Achtung und ehrlicher Absicht, dem öffnen sich die Tore. Nicht aus Neugier, sondern aus einer echten Frage heraus: Wie kann ich helfen? Was will gesehen werden? Welches Heilkraut wird gebraucht?
Die Anderswelt ist kein Ort für Schaulustige. Die Märchen lehren das. Die gierige Pechmarie, die ohne Demut kommt, wird nicht belohnt. In slawischen Sagen mahnt die wilde Baba Jaga: «Ich mag es nicht, wenn zu viel gefragt wird. Die Neugierigen fresse ich.» Es braucht Mut – und Reinheit.
Volksheilkunde und Brauchtum rund um den Holunder
Neben seiner mystischen Bedeutung war der Holunder auch eine hochgeschätzte Heilpflanze. Holunderblütentee ist schweisstreibend und hilft bei Erkältungskrankheiten, besonders bei Fieber. Der schwarze Holundersaft stärkt das Immunsystem, lindert Husten und enthält viele Vitamine. In der Volksmedizin wurde der Holunder als «Apotheke des Bauern» bezeichnet – kaum eine Pflanze konnte so vielseitig eingesetzt werden: gegen Schnupfen, Fieber, Hautleiden, sogar bei Rheuma.
Zur Johanniszeit sammelte man traditionell die Blüten – man trocknete sie an einem schattigen Ort und verwendete sie für Tees, Sirup oder als Badezusatz. Die Johannisnacht selbst war eine Zeit der Kräutersuche, des Räucherns und der magischen Praktiken. Besonders wirksam galten Pflanzen, die in dieser Nacht gepflückt wurden, wenn der Tau noch frisch darauf lag.
Ein stiller Wächter am Wegrand
Wenn Du also in diesen Tagen an einem Holunderbusch vorbeigehst, halte kurz inne. Vielleicht verströmt er gerade seinen Duft in die laue Abendluft. Vielleicht summt eine Biene darin. Vielleicht flüstert etwas. Der Holunder ist kein gewöhnlicher Strauch – er ist ein stiller Wächter, ein Schwellenbaum, ein Tor.
Und wer sich darunter setzt – nicht mit Hast, sondern mit stillem Herzen –, der wird vielleicht beschenkt. Mit einem Bild, einem Traum, einer alten Erinnerung. Vielleicht ist es Frau Holle selbst, die kurz über den Schleier schaut.
Quellen & weiterführende Literatur:
- Erika Timm: Frau Holle, Frau Percht und verwandte Gestalten. Zur Geschichte eines Mythos, Verlag für Regionalgeschichte, 2003
- Wolf-Dieter Storl: Pflanzen der Kelten, AT Verlag, 2000
- Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, De Gruyter
- Richard Beitl: Wörterbuch der deutschen Volkskunde, Kröner Verlag
- Brüder Grimm: Frau Holle, KHM Nr. 24
- Marija Gimbutas: Die Sprache der Göttin, Fischer Verlag




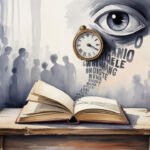


Eine wunderschöne Wertschätzung einer Pflanze, die wahrlich überrascht.
In meiner Nähe fühlt sich Frau Holle im Märchenkeller des Pöstlingbergs sichtlich wohl und freut sich über die fleißige Marie. Dass Frau Holle tatsächlich auch eine uralte Göttin ist, habe ich heute bei Dir erlesen. Das freut mich sehr.
Lasse liebe Grüße hier, C Stern
Wie schön zu hören, dass Frau Holle auch im Märchenkeller des Pöstlingbergs ein liebevolles Zuhause gefunden hat – dort passt sie ganz gewiss hin, mit ihrer Verbindung zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Es freut mich sehr, dass der Beitrag Dir neue Facetten dieser uralten Gestalt näherbringen konnte. Frau Holle ist eben weit mehr als die Hüterin von Schnee und Ordnung – sie ist eine Wegweiserin zwischen den Zeiten und Bedeutungen, und vielleicht auch eine stille Begleiterin auf so manchem inneren Pfad.